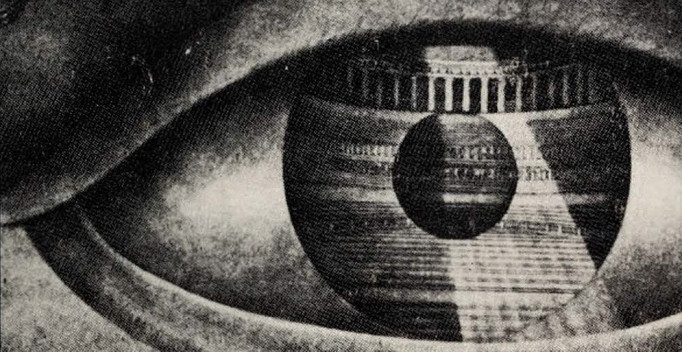Sechs Jahre nach seinem ersten Kinospielfilm Grauzone legt Fredi M. Murer einen Film vor, der nicht nur eine Wiederholung, nicht nur eine Neufassung der früheren Ansätze, nicht nur ein Fortschritt gegenüber den früheren Werken ist, sondern die Summe all dessen, was der Autor in über zwanzig Jahren beharrlicher, kompromissloser Arbeit geleistet hat: einen kompletten Film. Der Film des 45jährigen Poeten des Neuen Schweizer Films ist zweifelsohne der reichste und lebendigste Schweizer Film dieses Jahres. Er wird —zusammen mit Tanners Jonas, Yersins Les petites fugues und Imhoofs Das Boot ist voll — zu den wichtigsten Nachkriegskinofilmen aus der Schweiz gezählt werden.
Die Geschichte zuerst, weil sich die ganze Bildtechnik, die Schauspieler und der Ton in ihren Dienst stellen: Auf einem abgelegenen Bergheimet wohnen die „Jähzorigers“, Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Sie leben zurückgezogen, kommunizieren mit den Eltern der Mutter übers Tal mit Zeichen; ein paarmal im Jahr sehen sie sich: zuweilen gehen sie auch ins Tal, der Vater vor allem; er kauft ein, verkauft auf dem Markt ein Stück Vieh; an grossen Feiertagen gehen alle zusammen zur Kirche. Der Sohn ist gehörlos von Geburt; die Tochter, Belli, hat der Vater von der Schule genommen; sie hilft auf dem Hof und ist die Lehrerin des „Bubs“ geworden. In vielen kleinen Ereignissen erzählt Höhenfeuer die Beziehung der Geschwister und der Eltern, eine zunehmende Zuneigung der Geschwister und eine zuerst fast unmerkliche Entfernung von den Eltern. Zwischen Belli und dem Bub bahnt sich eine Liebesgeschichte an. Wenn Belli den Bub, der sich vor dem Vater auf die oberste Alp geflüchtet hat, in seiner Welt besucht, werden die Beiden ein Liebespaar. Belli wird schwanger, und der Jähzorn des Vaters bricht durch. Doch die Liebe der beiden Jungen verteidigt ihren Platz; in Notwehr tötet der Bub den Vater, und die Mutter stirbt ihm nach. Belli und der Bub betrauern und begraben die Eltern im Schnee, geben den Grosseltern ein Zeichen. Der Bub nimmt am Tisch, im Bett, im Stall die Stelle des Vatersein. Belli ist einverstanden.
Die klare, gradlinige Geschichte, die nur einmal von einer Rückblende unterbrochen wird — der kleine Bub und Belli kuscheln sich in einer Gewitternacht im Bett aneinander wie Tiere —, erzählt Fredi M. Murer unter Entfaltung des breitesten Fächers einer präzisen und sinnlichen Filmsprache. Jede Szene, ja jede Einstellung baut diese Welt und ihren Geist vor dem Zuschauer auf. Die ethnographische Genauigkeit führt Höhenfeuer nicht in den „modernen Heimatfilm“, im Gegenteil: Die Bedeutsamkeit der Erfindungen, ihre differenzierte, klassische Durchführung lassen das Heimet und die Alp zu einem Bühnenraum werden, zu einem Mikrokosmos, der die Welt bedeutet. Murer hat nicht am naturalistischen, allenfalls „autgeklärten“ Bauerndrama Mass genommen, sondern an grosser tragischer Literatur. (Vielleicht hat ihm seine Regieassistenz bei Luca Ronconis Zürcher Medea dazu den letzten nötigen Mut gemacht.)
Auf dieser grünen Insel inmitten der schroffen Berge treffen die Wünsche und Affekte, die Triebe und die Aengste direkt aufeinander, schaffen ein System von Abhängigkeiten und Grenzen, von Anziehungen und Konflikten. Mit unzähligen Einzelheiten, kleinen Zeichen und wenigen Worten baut Murer die Liebe der Geschwister auf und macht begreiflich, dass die Liebenden allein in der Welt (aber nicht fremd in der Welt) bleiben müssen. Die signifikanten Details stellen die Beziehung zu Legenden und Mythen her; der Autor scheint mit schlafwandlerischer Sicherheit die Steine wegzuräumen, die im Laufe der Zivilisationsgeschichte die elementaren Gefühlskräfte des Menschen verschüttet haben. Er steigt zurück in die Kindheit, nicht nur zweier Menschen, sondern auch der Menschheit.
Vier Darsteller leben diesen Weg zum reinen Konflikt der Gefühle und Wünsche vor, diskret Vater und und Mutter (Rolf Illig und Dorothea Moritz), offen und kreativ die Kinder (Johanna Lier und Thomas Nock).
Zwei dialogintensive Szenen im ersten Viertel des Films — ein kleiner Familienstreit und der Besuch der Kinder bei den Grosseltern — sind möglicherweise etwas statisch geraten, aber sie öffnen den Weg zu einem Ton-Film, wie man ihn nur sehr selten trifft. Der Ton ist es vor allem, der die Schleusen der Assoziationen öffnet, den engen, heutigen Raum weitet auf Zeitloses, „Ewiges“, wenn man will. — Das Bild (Pio Corradi) ist von einer unglaublich zarten Genauigkeit; das Bild ist es, das die Gegenwart der Handlung garantiert. — Fugenlos gehen Naturgeräusche in die Windharfenmusik von Mario Beretta über; im Schweizer Film hat es noch nie eine solch differenzierte Tonwelt gegeben wie in Höhenfeuer.
So ist es fast falsch, wenn man feststellt, dass Thomas Nock, dieser wunderbar natürliche Schauspieler, der den taubstummen Bub mit jeder Faser zu erleben scheint, den Film trägt. Alles dient ihm und seiner Geschichte, ohne bloss Untermalung zu sein. Doch sein Weg bestimmt den Gang der Ereignisse, und sein Weg fasst auf poetische Weise die Geschichte jedes Menschen. Fredi M. Murer beschreibt (evoziert) eine Initiation. Sein Bub ist ein Kaspar Hauser, der eines Tages „Ich“ sagt, nach langem Ringen, nach vielen Schmerzen. Auf der obersten Alpstaffel baut er mit Steinen seine Stadt (er wird Gestalter, Künstler), er wird ein Liebender, der seine Liebe verteidigt. Dass er und Belli ein Tabu brechen, erschreckt einen nicht. Und am Schluss denkt man kaum mit Bangen daran, was geschehen wird, wenn der Schnee geschmolzen und die Wege zum Heimet wieder offen sind.
Alle Kunst ist auch Autobiographie; man spürt sie in Höhenfeuer, aber nirgends im Verhältnis 1:1; man spürt, wie Murer in die eigene Kindheit zurücksteigt, und wie Kindheit mit Menschlichkeit und Geschichte der Menschheit zu schaffen hat. Und es wird einem klar, dass Höhenfeuer die Summe von Murers Kinderfilmen (Marcele Christoph und Alexander), von seinen Künstlerfilmen und von seinem ethnographischen Wir Bergler in den Bergen ... ist. Marcel verbringt seine Tage im Steinbruch, Sadkowskv baut in Sad-is-fiction seine Steintürme im Maggiatal, Hans- Ruedi Giger stürmt in Passagen aus seiner Stadtangst in die alpine Steinwüste hinaus. Und Alfred von Grauzone fühlt sich „zu Orten seiner Vergangenheit hingezogen“.