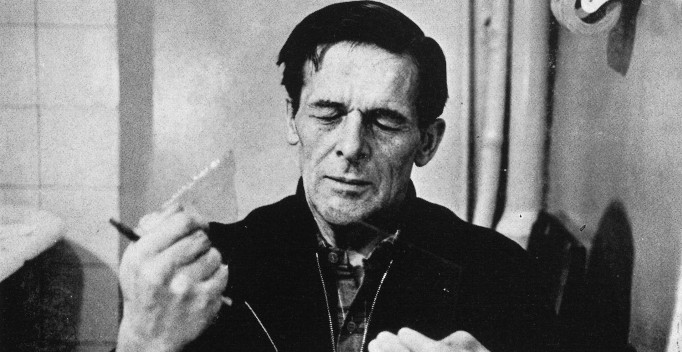Es dürfte ausserhalb jeder Frage stehen, dass ein Zusammenhang zwischen dem für einen Film verfügbaren Budget und dem dadurch Darstell- und Realisierbaren besteht. Die anwendbaren Mittel konditionieren Filmsprache und Stil. Und da sich Thema und Darzustellendes auf diese Ausdrucksmöglichkeiten berufen, werden auch die Filminhalte tangiert.
Dies hat zur Folge, dass sich — jedenfalls bei flüchtigem Hinsehen — die Filme des «Groupe 5» in mehreren formalen und thematischen Belangen gleichen, und zwar bezeichnenderweise am Anfang mehr als in den letzten Werken, für die bereits ein etwas grösseres Budget zur Verfügung stand. Auch fehlt es nicht an Interpretationen, die einen Einfluss durch die Television plausibel belegen wollen.
Dennoch stösst ein Versuch, formale und inhaltliche Parallelen aufzuzeigen und auf Budget oder TV-Erfahrungen zurückzuführen, auf etwelche Schwierigkeiten; zu leicht setzt man sich der Gefahr eines vereinfachenden, spekulativen Systemzwangs aus, der auf dem Papier zwar beeindruckend, der Sache selbst indessen weitgehend fremd sein mag. Bei jedem der Autoren stellt sich die Frage anders; die durch das Budget geschaffenen Grenzen weisen den einen (etwa Goretta und Roy) einengende Schranken, während dem Soutter und zum Teil auch Tanner gerade im so abgesteckten Feld ihre Persönlichkeit fanden und weiterentwickeln. Von einer eher globalen Sicht des Problems ausgehend, soll der Artikel versuchen, die behaupteten Zusammenhänge aufzufächern oder gar in Frage zu stellen, um dann die tatsächlichen, differenzierten und zum Teil auch nicht beweisbaren Wechselwirkungen zu skizzieren.
Grenzen und Gemeinsamkeiten
Als kulturelles und insbesondere filmisches Entwicklungsland kann sich die Schweiz — wenn überhaupt — offensichtlich nur einen armen Film leisten. Mit 30 000 Franken drehte Soutter 1966/67 sein erstes Werk; Tanners Debüt kostete nur 120 000 Franken — zehn oder weniger Prozent dessen, was andere kleine Produktionen verschlingen. Aber man musste wählen: «Entweder während drei von vier Jahren herumreisen, um die Finanzen zu sichern, die es für den Film von einigem Format nun einmal braucht — oder drehen, drehen um jeden Preis» (Tanner). (Anmerkung 1). Damals galt es tatsächlich, vorab in der Westschweiz (wo nie so etwas wie eine Filmindustrie existiert hat), zu beweisen, dass der Film überhaupt existierte: «Man musste ihn praktisch erfinden» (Soutter).
Das bedeutete indessen: Man musste mit sehr kurzer Drehzeit — drei bis vier Wochen — durchkommen. Die Kamera konnte nicht oder kaum bewegt werden; als Material kam nur 16 mm und Schwarzweiss in Frage. Der Direktton drängte sich auf, die Beleuchtung blieb rudimentär. Das bedingte weitere Einschränkungen. Der begrenzte Kameraeinsatz verunmöglichte das Spiel mit den Blicken und dem Dekor fast ganz. Der Standort der Kamera hatte sich nach den einfachsten Beleuchtungsmöglichkeiten zu richten. Viel Aktion und eine grosse Anzahl von Drehorten, vor allem in Interieurs, konnten nicht miteinbezogen werden (Anmerkung 2). Das 16 mm-Material seinerseits verbot — wegen des Aufblasens — starke Sonneneinwirkung: Man drehte vorzugsweise im Herbst oder Winter, man zeigte eine graue, neblige, feuchte Schweiz. Als Ausdrucksmittel wurde dadurch der Dialog besonders wichtig; als Ausgangsmodell kam primär der Einzelne, das Individuum in Frage: Anstatt «cinéma d'action» machte man nun «cinéma d'acteur»; es war weder ein romaneskes noch ein peripetien- und intrigenreiches Kino aufzubauen.
Technisch konnte so keine Perfektion erreicht werden; es fehlte auch die Zeit (beziehungsweise das Geld) zum Nachdrehen. «Man musste eine gewisse Marge von Fehlerhaftigkeit miteinbeziehen» (Tanner). Die Arbeitstechnik war somit gegeben: Mit einer äusserst kleinen Equipe, mit wenigen, dem Autor bereits bekannten Darstellern wurde der Film abgedreht, es entstand eine fruchtbare, kreative Atmosphäre (Anmerkung 3). «Man konnte sich kein langes Zaudern und Ausklügeln leisten» (Soutter). Und Tanner: «Man drehte strikt nach Drehbuch. Andernfalls würde man sich den Kopf einrennen.» Die kleine Equipe und die TV-Erfahrungen brachten indessen den Vorteil grosser Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit.
Licht, Ton, Arbeitsweise machten die Filme einander verwandt. So empfand es jedenfalls das Publikum. Und man fühlte etwas Neues: eine Direktheit, eine Frische, die das Kino sonst kaum zu bieten vermochte; ja, viele glaubten gar, hier würde improvisiert. Etwas Reportagehaftes schien die Filme auszuzeichnen (Anmerkung 4).
Doch nicht nur Darsteller, Direktheit und Ton schufen den Eindruck von Gemeinsamkeiten. Gerade Kameraleute wie Berta (bei Tanner) und Edelstein (bei Soutter) verstanden es, den grauen, grobkörnigen Bildern eine besondere Ästhetik abzugewinnen. Zu dieser Entwicklung wirkt die hervorragende Dialogarbeit gerade etwa von Tanner und Soutter als Pendant (Anmerkung 5). Die Bedeutung der Natur, der Humor und der introspektive Zug verbanden die verschiedenen Filme zusätzlich: der Umstand, dass man sich der Realität nie ganz stellt, immer wieder davon Distanz nimmt und lieber auf der Schwelle beobachtet, verrät indessen eine allgemeine westschweizerische Wesensart, die auch in der Literatur festzustellen ist und etwa in Roys Black-Out selbst das Thema — die Resignation, die Abkapselung — prägt. In all diesen Filmen wird — wenn auch verschiedenartig — die soziale Wirklichkeit eingewoben; die Revolte oder deren Unmöglichkeit erscheint als Leitfaden; man stellt die Mechanismen der Gesellschaft in Frage, zeigt ihre pervertierenden, zerstörerischen Kräfte, von Vivre ici über Le Fou, Jour des Noces bis L’Invitation, in Tanners Filmen und auch bei Soutter, wo die Figuren sich von ihren sozialen Rollen, ihren aufgedrängten Verengungen und Funktionen lösen müssen oder sollten.
Doch wie weit stimmen derart absolut postulierte Gemeinsamkeiten überhaupt? Wie weit sind sie auf das Budget zurückzuführen, und — sofern dieser Bezug stimmt — in welchem Mass spiegeln sie das wirkliche Temperament und Ausdrucksregister des betreffenden Autors? Bedeuten die angeführten Stilmittel den natürlichen Rahmen, in dem sich der Einzelne entfalten kann, oder engen sie, im Gegenteil, Sprache und Thematik des Autors ein?
Einschränkungen und Trennungslinien
Der «Groupe 5» hat die Regisseure Tanner, Soutter, Goretta und Roy nicht «gemacht». Seine Entstehung bedeutet lediglich eine — allerdings mitentscheidende — Zäsur in der Entwicklung dieser Autoren. Als sie ihre Filme zu drehen begannen, gab es gar keine Alternative zum Kleinst-Budget-Film. Soutter, der zwar anerkennt, dass «bei kleinen finanziellen Mitteln viele Ideen nicht umgesetzt werden können», fand sich, wie weitgehend auch Tanner, darin besser zurecht als Goretta und Roy, die ihre Filme eher trotz des kleinen Budgets und gegen dessen Schranken schufen. So hätte Tanner etwa für La Salamander fast das doppelte Budget verlangen können. Doch: «Dieser Betrag wäre für meinen Film ein falsches Budget gewesen.» Soutter warnt sogar vor zu hohen Budgets, «weil sie einen Bruch mit den bestehenden Ausdrucksmitteln bewirken würden.» Verhält es sich also so, dass zuerst der Stil — und dann erst das Budget da war? Bei Soutter spielt noch eine andere Überlegung mit: Man kennt seine Sprache, seinen Stil, seine Themen. Man weiss, davon ausgehend, wie gross das Publikum etwa sein könnte, das derartige persönliche Filme ansieht. Auf dieses Publikum muss das Budget ausgerichtet sein; die Sprache aber ist als Konstante vorausgesetzt. Es verhält sich also nicht umgekehrt und auch nicht so, dass zuerst das Geld da wäre und dieses dann erst den Stil bestimmte. So will Soutter seine Freiheit auch heute noch nicht aufgeben, indem er sich in Grossproduktionen einlässt. «Man würde untergehen; man erstickte unter den Forderungen, und nach einem Erfolg stünde man erst recht unter einem Produktionszwang.»
Roy dagegen benötigt grösseren technischen Aufwand, er liebt eher das Barocke, Aktionsreiche, das Spiel mit dem Dekor. Gorettas Stil geht seinerseits mehr in die Richtung des romanesken Films: «Ich brauche eine Kamera, die Blicke, Gesten, Bewegungen beobachtet und einfängt; mit ihnen sowie mit dem Dekor arbeite ich in erster Linie, und nicht mit dem Dialog.»
Hier brechen die (vermeintlichen) Gemeinsamkeiten auseinander. Sie stimmen nur im Material, nicht aber in dessen Anwendung. Tanner beispielsweise misstraut der oberflächlichen «Realität» des Bildes und will dieses so weit wie nur möglich reduzieren; für ihn ist der Zusammenhang zwischen den einzelnen Einstellungen wichtiger als diese an und für sich. Die Montage soll sichtbar sein, als Wesenszug eines eigentlichen «cinéma de rupture», wie es auch für Soutter zutrifft (Anmerkung 6). Soutter seinerseits nutzt das Approximative der Technik, um diese ganz vergessen zu machen, und erreicht dadurch mit seiner Sprache, die stark von Rhythmus und Poesie, von einem transparenten Geflecht aus Stimmungen und Fragmenten lebt, ein dichtes, lebensvolles Filmklima, das «perfekte» Fabrikationen nie schaffen könnten. Goretta dagegen baut sehr auf das minuziös ausgearbeitete (reale) Bild, auf Präzision; seine eher konventionelle, geschmeidige Montage ist komplizierter.
Für die begrenzten Gemeinsamkeiten gibt es indessen noch eine andere Erklärung: Die Autoren der «Groupe 5» gehören derselben Generation an; sie sprachen während langer Zeit gemeinsam von ihren Filmen, ehe sie sie drehen konnten. Sie fühlen sich alle mehr oder weniger ausserhalb der Gesellschaft, in der sie leben. Sie sind «in einem moralischen und geistigen Konzentrationslager» (Tanner).
Was schliesslich die mögliche Beeinflussung durch die Arbeit für die Television betrifft, so steht gerade der Langspielfilm der Schein-Objektivität und dem penetranten «Realismus» des kleinen Bildschirms diametral gegenüber. Tanner arbeitete übrigens nur kurze Zeit fürs Fernsehen; Goretta dagegen seit 1958 bis heute. Auch Roy gehört heute noch zur TV, und Soutter seinerseits will die Zusammenarbeit nicht ganz aufgeben; so wie Goretta in Jean-Luc Persécuté und Jour des Noces über die formalen Auswirkungen der TV-Praxis reflektierte, bot diese Tätigkeit Soutter die Möglichkeit, gewisse seiner Stilmöglichkeiten, fast schon experimentell, zu prüfen (Les Nénuphares), wenn dies auch nur auf den Dialog beschränkt blieb (Anmerkung 7).
Freiheit durch kleines Budget
Der ganze Fragenkomplex erscheint letztlich als eine Schlange, die sich im eigenen Schwanz festgebissen hat, und das besitzt, für einmal, seine Richtigkeit: In Ermangelung von Alternativen — niemand kann zugleich Debütfilme mit kleinstem und mit grossem Budget drehen — muss die eine Feststellung auf die andere verweisen, muss das eine das andere relativieren, in Zweifel stellen.
Zum vorsichtigen Versuch einer Synthese führt wohl Tanners Äusserung: «Ich ziehe es vor, die Grenzen der Inszenierungsmöglichkeiten zu konfrontieren und auszunutzen, anstatt sie zu umgehen.» Ob diese Grenzen dem wahren Stilwillen entsprachen oder nicht: Sie erlaubten eine völlige Kontrolle der Mittel, machten die Autoren verantwortlich für jeden Belang der Produktion. «Kleine Budgets», so Soutter, «fördern die gründliche Lehre und Vertiefung des filmischen Ausdrucks.» Gerade Werke wie James ou pas, Charles mort ou vif, Les Arpenteurs, zum Teil aber auch Le Fou und andere verstärken den Eindruck, dass dieser Bereich und die daraus entstehende Vervollkommnung von Technik und Sprache der Entwicklung dieser Autoren eher förderlich als ein Hindernis waren. Die dadurch gewonnene Freiheit von der üblichen Produktion, vom Druck des Marktes und Kommerzes, diente zweifellos dem weitgehend ungestörten Abtasten und Entdecken der eigenen Persönlichkeit: Autorenfilme finden, wenn nicht allein, so doch vorwiegend und am besten hier ihr privilegiertes, fruchtbares Arbeitsfeld. Denn im Mittelpunkt steht doch die Filmsprache, und auf sie erst lassen sich Thema und Stoff applizieren. Wer von der anderen Seite seine Filme angeht, wird — und das haben im In- und Ausland ungezählte Streifen bewiesen — an den Diskrepanzen zwischen Möglichem, Eigenem und den Forderungen durch Aufwand, Prätention und Unpersönlichem scheitern. Vielleicht ist es kein Zufall, wenn gerade Roy, der sich am stärksten an den gegebenen Inszenierungsgrenzen stösst, am wenigsten als persönlicher Autor auftritt und dass auch Tanner und Soutter Unverwechselbareres, Tieferdringendes geschaffen haben als Goretta. Damit hängt auch zusammen, dass Roy für Black-Out auf den sonst üblichen Direktton verzichtet hat, was sich für den Film als grosser Nachteil erwiesen hat (Anmerkung 8).
Ein kleines Budget gefährdet zudem, nach einem Misserfolg, den Autoren niemals in dem Mass, wie dies bei einem aufwendigen Film der Fall wäre: Soutter postulierte anfänglich nicht umsonst das «Recht auf Misserfolg»; die weiteren Produktionen musste er nicht von der Kinokarriere abhängig machen. Roy dagegen steht nach Black-Out (1970) heute noch in Schulden. Zudem liegt gerade darin, dass die Autoren der «Groupe 5» im allgemeinen die Grenzen akzeptierten und nicht vorgaben, grössere Kinofilme (mit unzureichenden Mitteln) zu drehen, ein Hauptfaktor für den internationalen Erfolg des Filmstils, für dessen Eigenart und Unverwechselbarkeit. Der Beginn beim Nullpunkt schuf für einmal keine Komplexe, weil man sich erst gar nicht an anderen mass.
Mehr Geld: wozu?
Widerspricht diesen Feststellungen nun die zukünftige Entwicklung, vor allem jene der Budgets? Werden sie widerlegt durch Tanners zurzeit entstehenden Film Le milieu du monde, der rund siebenmal so teuer ist wie Charles mort ou vif? Hier gilt es hartnäckige Missverständnisse auszuräumen. Sie nisten sich dort ein, wo man glaubt, 800 000 oder 900 000 Franken bedeuteten heute, in einer Co-Produktion, ein grosses Budget. Selbst Charles könnte, unter den gleichen Herstellungsbedingungen, heute niemals mehr mit 120 000 Franken gedreht werden. Zudem wurden damals die Techniker und Schauspieler weitgehend mit blossem Enthusiasmus bezahlt. Heute aber sollen die Leute ihre angemessenen Gehälter bekommen. Mit den Co-Produktionen steigen zudem die Kosten erheblich, so auch die Ansätze für die nach ausländischem Tarif bezahlten Beteiligten; die Laborauslagen sind nunmehr auch zwei- bis dreimal höher.
Man bleibt also auch mit einer knappen Millionenproduktion im Bereich des Klein-Budget-Films, zumindest stilistisch, sprachlich und thematisch. Alles andere wäre nur ein linguistisches Experiment. Dennoch lassen sich die Folgen effektiver, auf die Gestaltungsmittel bezogener Budgetverbesserungen bereits in Le Retour d’Afrique und L’Invitation ablesen. Die eine Auswirkung betrifft das Dekor, die andere den Einsatz der Kamera; mit beiden hängt die Beleuchtung zusammen.
Die Filmsprache entwickelt sich harmonisch nur auf empirische Art; jeder Film stellt somit einen Lernprozess dar, der sich auf das nächste Projekt niederschlägt. Für die einen führt somit ein höheres Budget lediglich zur Vertiefung des Bestehenden sowie — und das erhöht die Kosten wesentlich — zu längeren Drehzeiten. Wer früher während dreier Wochen drehte, braucht heute deren fünf; Charles wurde in weniger als vier Wochen beendet; für Le milieu du monde plant man mehr als die doppelte Zeit. Das hat weniger mit der Sprache als mit deren Verbesserung zu tun. Dagegen brauchen vor allem Goretta, aber auch Tanner und Roy mehr Kamerafahrten, präzise Schienenführung, ja nun selbst Krane. Früher hiess es: Wo lässt sich dieser Raum am leichtesten ausleuchten? Nach diesen Möglichkeiten musste sich die Kamera dann richten. Bereits in Le Retour d’Afrique konnte, dank vermehrtem und besserem (und somit teurerem) Einsatz der Techniker, umgekehrt verfahren werden: Man wählte zuerst den besten, «richtigen» Standort der Kamera, und dann erst wurde für das richtige Licht gesorgt. Und wie Roy und Goretta begann Tanner mit dem Dekor zu spielen: es wurde, als graue, zubetonierte, zerstörte und zerstörende Stadt, eine Art Hauptfigur. Ohne einen Film der Gesten, des Romanesken zu machen, ohne die Konflikte und Konfrontationen psychologisch oder psycho-soziologisch abzuleiten (wie Goretta), begann Tanner, in Vertiefung seines dialektischen Filmstils und seines Verhältnisses zu Realität und Fiktion, mit der bewegten Kamera zu arbeiten: Sie wird aktives Ausdrucksmittel, eine Protagonistin, die selbständig spricht, das Aufgenommene kommentiert und, wie etwa bei Goretta, deutet, verstärkt oder neutralisiert.
So legt auch diese Konkretisierung dar, dass bis zu einem gewissen Punkt das Budget die Filmsprache zwar tangiert, nicht aber bedingt oder grundsätzlich verändert, und dass das Thema, das übrigens wohl alle Autoren der Gruppe gefunden haben, nur mit der Sprache, nicht aber mit dem Budget direkt zusammenhängt.
Abschliessend muss die möglicherweise entscheidende Phase des Übergangs zu grösseren finanziellen und somit technischen Mitteln noch von einer anderen, allgemeinen Seite beleuchtet werden: Denn obwohl man am Anfang der «Graupe 5»-Filme gar nichts anderes kannte, als eben mit minimalstem Budget zu drehen, hat sich, abgesehen von der Verschiedenheit der einzelnen Autorenwerke, so etwas wie ein westschweizerischer Film entwickelt, der ja auch ausserhalb der Gruppe bestätigt wird (nicht durch Reusser, der einen notabene erfolglosen Einzelfall darstellt, sondern durch Gonseth, Edelstein, Butler, etc.).
Im Gegensatz zu den Anfangsjahren öffnen sich heute nun andere Filmvorstellungen und -möglichkeiten. Doch hat nicht gerade die Filmgeschichte gezeigt, dass ein jäher Ausbruch aus der einmal gefundenen oder konditionierten Filmsprache zumeist zu deren Verlust, zum Misserfolg führt? Auch neuere Beispiele fehlen nicht: man denke etwa an die «Nouvelle Vague», an das «New American Cinema», an die «Nova Vlnà» oder das «Cinema Nôvo». Wo sich Tschechen oder Lateinamerikaner den internationalen Inszenierungs-Touch oder Aufwand zulegten, wo Polen, Franzosen und Vertreter des «Free Cinema» einem fremden Muster nacheiferten, waren Selbstverlust von Sprache, Persönlichkeit und so auch des Gehalts fast immer die Folge. Jedenfalls gilt es, den Budgetbereich herauszufinden, der gross genug ist, um die Freiheit des Stils, dessen harmonische Entwicklung und Vervollkommnung zu ermöglichen, der indessen nicht so gross ist, dass er die kreative Freiheit zerstören könnte. (Anmerkung 8). Auch Schauspieler, deren kreative Funktion innerhalb der Groupe-5-Equipen bekannt und wichtig ist, bestehen nicht einfach in jedem Filmtypus; so wenig wie eine Marie Dubois oder ein Jacques Denis in einer aufwendigen Produktion vorstellbar ist, würde ein Brando oder Marvin in einen Genfer Autorenfilm passen. Und auch das hat mit Sprache, Stil und Thema zu tun, und nicht mit dem Budget, das sich heute allerdings mehr als zuvor den wirklichen Bedürfnissen der Autoren anzupassen hat und so aus einer mit der Zeit gefährlichen Sackgasse herausführen muss. Es wäre (zu) schön, wenn dies auch bei den verantwortlichen, mass- und kreditgebenden Instanzen eingesehen werden könnte. Doch vielleicht ist das bereits eine politische Frage, die den Rahmen des vorliegenden Themas sprengt.