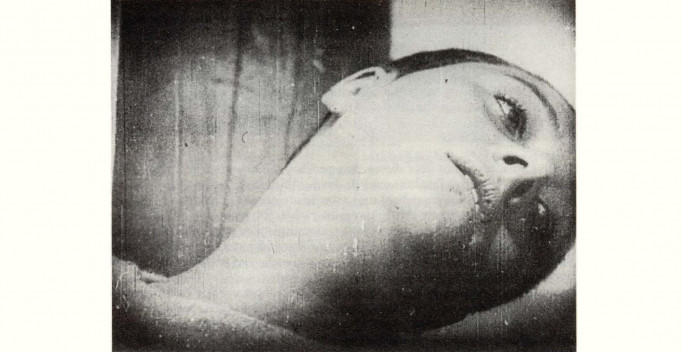I. Filme machen, die weder analysieren noch erklären
Der Schweizer Film befinde sich in einer Krise, hört man überall sagen. Aber wovon ist genau die Rede? Die meisten sprechen von Geld, einige von Ideen, aber niemand — und das ist kein Zufall — spricht vom Film.
Wegen seiner hohen Produktionskosten befindet sich der Film seit immer in unstabilem Gleichgewicht auf dem schmalen Grat, der die Grenze zwischen Kunst und Industrie bildet. In der Schweiz hat der Binnenmarkt, wegen des Zusammenlebens von drei kulturellen Mikrokosmen auf demselben winzigen Gebiet, nie die Existenzfähigkeit einer reellen Filmindustrie ermöglicht. Ob man will oder nicht, hängt Sein oder Nichtsein des Schweizer Films von seinem Status als subventionierter Autorenfilm ab. Das ist zugleich sein Hauptmangel und seine positivste Eigenschaft. Seine Qualität, weil er nie den Standardprodukten der Industrieproduktion gleichen wird; sein Mangel, weil er gerade deshalb nie die Mittel haben wird, sich durchzusetzen — sei es auch nur auf dem europäischen Markt — da er schon auf seinem eigenen nationalen Markt auf keine Verleiherleichterungen gegenüber der ausländischen Konkurrenz zählen kann. Demzufolge ist der Glaube, die Schweizer Filmregisseure könnten mit gleichen Waffen das Publikum erobern, total illusorisch. Sie würden nicht nur diesen Kampf verlieren, sondern auch noch das Einzige, das ihnen bleibt: eine gewisse Authentizität.
Wenn es heute eine „neue“ Krise gibt, so ist sie sicher von grundlegenderer Art und gerade deshalb interessanter zu analysieren. Denn sie situiert sich jenseits der Probleme der zu gebrauchenden Mittel und Inhalte: sie stellt das Problem der Filmsprache im allgemeinen, d. h. der Wahl zwischen einer naturalistischen Auffassung und der Entfaltung einer individuellen Einbildungskraft.
Seit seinem Neuanfang in der Mitte der sechziger Jahre hat es sich der Schweizer Film zur Aufgabe gemacht, den helvetischen Alltag offenzulegen. Diese Neuorientierung, provoziert durch die Opposition zum sogenannten industriellen Film, hing natürlich ab von der totalen Abwesenheit einer Produktionsinfrastruktur einerseits und einer Filmtechnik andererseits, die unter dem Einfluss des Fernsehens sehr handlich geworden war.
In einem Ausspruch, der aus dem Jahre 1969 stammt, dem Entstehungsjahr von Charles mort ou vif?, fasst Alain Tanner exemplarisch diese allgemeine Tendenz der Filmemacher, die schweizerische Wirklichkeit auszudrücken, zusammen: „Unsere Strassen, Häuser, Mitbürger beginnen sich in gesehene, beobachtete und kommentierte Grössen zu verwandeln . . . Lange Zeit haben wir geschwiegen. Jetzt beginnen wir zu sprechen, und unsere Mundart ist wahrscheinlich nicht schlechter als andere. Wir reden also; wir reden mit Euch.“
So griffen zunächst die Filmregisseure zu ihren Kameras und ihren Mikrophonen, um als Zeugen ihrer Zeit die Wirklichkeit zu beobachten und aufzunehmen; die Kamera, gekoppelt mit der direkten Tonaufnahme, fing Bilder in langen „Wahrheitsmomenten“ auf, wie das objektive Auge des Entomologen, sich in der Illusion wiegend, die Wirklichkeit sei direkt auf die Leinwand fixierbar. Später hat sich die Kamera distanziert, mit Absicht; sie verzichtete noch stärker auf Nahaufnahmen, benutzte von der Handlung unabhängige Schwenks, um ruckartig die Identifizierung der Bilder mit der Wirklichkeit zu zerstören. Man wollte mit Distanz analysieren, eine sachliche Aussage machen, aber ebenfalls die Wirklichkeit mit mehr Engagement betrachten. Dieses Vorgehen verhehlte auch eine kühle Determiniertheit: die Weigerung, sich in das Spiel der Emotionen einzulassen.
Jahr für Jahr hat also der Schweizer Film, sowohl der Dokumentarfilm wie der Fiktionsfilm, geduldig eine eindrückliche realistisch-kritische Bestandsaufnahme des Territoriums durchgeführt. Zu diesem Zweck hat er vor allem, ausser einigen hervorragenden Ausnahmen, durch das Medium des Wortes gesprochen, wobei Bild und Ton sehr oft nur Träger einer schwatzhaften Aussage, einer Programmrede, eines Radiointerviews waren. Der erste Schock, ausgelöst durch die blosse Tatsache, auf der Leinwand Szenen aus unserem Alltag zu sehen, ist nun vorbei, und wir müssen zugeben, dass nach zwanzig Jahren die visuelle Bilanz des Schweizer Films ziemlich glanzlos und banal ausfällt.
Parallel dazu hat sich die Welt verändert. Erreichten am Ende der sechziger Jahre die kollektiven oder gemeinschaftlichen Ideologien, die eine Filmströmung hervorgebracht haben, in denen Subjektivität und Aesthetik zugunsten der politischen Aussage verdrängt worden waren, ihren Höhepunkt, so muss man heute einsehen: die Niederschläge vom Mai 68 und der verschiedenen Bewegungen, die ihm gefolgt sind, inklusive derjenigen in Zürich vor kurzer Zeit, sind definitiv vorbei. Und dies besonders in der Schweiz, wo doch schliesslich alles so gut geht; so dass jede Unruhe unwiederbringlich erlahmen muss und in eine Falle gerät, wie eine Wespe in ein Konfitürenglass.
Es gibt nur eine individuelle Wahrheit. Mit Dans la ville blanche leitet Alain Tanner, wie immer in Fühlung mit der Stimmung der Zeit, diese Neuorientierung ein. Er lässt, da er eine Liebesbeziehung zum Thema wählt, jede demonstrative Absicht fallen und gibt der Einbildungskraft ihre Dimension zurück. Sein schweizerischer Matrose, in Lissabon steckengeblieben, hört auf zu sprechen, um besser in sich hineinzuschauen. Und sein subjektiver Blick, wiedergegeben durch stumme Bilder, die im Super-8-Format gedreht worden sind, vermag es, uns auf intuitive Art tief zu rühren, und spricht uns emotionell mehr an als jeglicher Dialog.
Was einige Rückzug nennen, möchte ich demnach als Oeffnung bezeichnen. Denn die Forderung nach Subjektivität, die Aufwertung der persönlichen Wünsche und der individuellen Werte führt direkt zur Befreiung der Einbildungskraft.
Jeder Filmautor sollte über diesen Ausspruch von Dreyer nachdenken: „Alle Kunstwerke sind das Produkt einer Individualität. Aufgabe des Autors ist es, dem Film ein Gesicht zu geben, und zwar sein eigenes Gesicht.“
Die effektive Arbeit des Filmregisseurs besteht nicht darin, mehr oder weniger naiv die Wirklichkeit der Welt widerzuspiegeln, sondern im Gegenteil darin, sie von seinem eigenen Standpunkt aus mit Hilfe von Ton und bewegten Bildern künstlich wieder aufzubauen. Denn schliesslich ist wichtig, dass jemand uns eine Auffassung mitteilt, die seine eigene ist.
Hören wir auf, die Wirklichkeit zu reproduzieren. Richten wir unsere Blicke in das Innere unserer Köpfe und unserer Herzen. Gestalten wir unsere Fiktion. Schaffen wir Filme, die weder analysieren noch erklären, sondern die eine eigene Welt mittels einer spezifischen und autonomen Sprache gestalten.
II. Alles ist Rhythmus, alles ist Uebergang, einzig bleibt die Emotion, vielleicht
Eine andere Gefahr droht heute der Filmkunst im allgemeinen: die Banalisierung des Bildcodes. Im audiovisuellen Zeitalter (wie man gewöhnlich sagt) überschwemmen Bild- und Tonaussagen die ganze Erde. Diese Verallgemeinerung des Bildes auf der ganzen Zeit führt zu einer offenkundigen Banalisierung der Sprache, zu einem Gefühlsverlust hinter der Gewandtheit. Und ich spreche hier nicht vom Bildgadget, dem seelenlosen Produkt der Elektronik.
In der Tat, sobald eine Aussage jedermann erreichen soll, reduziert sich ihre Sprache auf die Ausführung eines zuverlässigen Rezepts. Die Vervielfältigung der Bilder führt zur Standardisierung, und nicht, wie man es naiverweise hätte erhoffen können, zum Hervorbrechen von individuellen Ausdrucksmitteln, die alle voneinander verschieden wären. Was heute dem Film am meisten fehlt, ist dieser Funken von Authentizität, der einen Autor von einem Fabrikanten unterscheidet.
Es gibt ein Missverständnis, das das Bild betrifft, und das ich aufklären möchte: Wenn ein Film unbewegte Bildausschnitte aufweist, wird ihm oft vorgeworfen, das seien ja Fotos!
Das Filmbild ist jedoch nicht von derselben Art wie das Foto. Der wesentliche Unterschied liegt in der Beziehung, die diese Bilder zu der Zeit haben. Die Fotoaufnahme beruht auf Augenblicklichkeit, das Filmbild auf Dauer. Grundsätzlich handelt es sich also um zwei Sprachen, die zwar parallel laufen, aber mit ganz verschiedenen Merkmalen. Und die Bewegung im Film wird nun wirklich weder von zappelnden Schauspielern geschaffen, noch von den Schwenks der Kamera auf der Suche nach einem Bildausschnitt. Die Bewegung im Film ist zunächst gegeben durch den Atem des Bildkorns, und dieser Atem kann nur durch die Dauer zustande kommen. Fotografieren heisst Bilder schaffen, die die Zeit anhalten; Filmen heisst Bilder schaffen, die in der Dauer atmen.
Der Film handhabt Illusion und Künstlichkeit in vierundzwanzig Bildern pro Sekunde. Wahr kann nur die ausgestrahlte und erfühlte Emotion sein.
Das Wesen des Films ist vergänglich; ihm fehlt das objektive Dasein. Die Beziehung des Zuschauers zum Film wird während einer begrenzten Zeit und in einem geschlossenen Raum hergestellt, der dem ununterbrochenen Ablauf von bewegten Bildern und von Tönen gewidmet ist. Was bleibt nach der Projektion vom Film übrig? Auf der einen Seite eine Spule mit dem Filmstreifen, der eine Folge von Momentaufnahmen enthält; auf der andern Seite ein Zuschauer, der voller Bild- und Toneindrücke und erfühlter Emotion ist. Der Film existiert infolgedessen nur während des Filmablaufs, während dieser Zeitdauer. Und seine Wirklichkeit ist nicht auf der Leinwand; sie beruht in der Beziehung des Zuschauers zum vom Autor geschaffenen Filmobjekt: diese Beziehung ist zunächst die der Emotion.
Von seinem besonderen Standpunkt als Regisseur aus gesehen hat Bresson recht, wenn er sagt, der Tonfilm habe das Schweigen erfunden. Im allgemeinen hat jedoch das Erscheinen des Tons, und folglich des Dialogs, das Bild zum reinen Träger entwertet. Um der wirklichen Ausdruckskraft des Bildes gerecht zu werden, muss man zu den Quellen des Stummfilms zurückgehen, in die Zeit, da das blosse Schwarzweissbild gezwungenermassen eine Uebertragung des Reellen implizierte. Jedes Bild war Teil einer globalen visuellen Partitur, in der die Beziehungen zwischen den Bildausschnitten und der Dauer der Bildeinstellungen sehr sinnreich, und mehr noch, sehr sinnlich waren. Diese Filme, die stumm waren, mussten Emotionen ausstrahlen, um verstanden zu werden. Der Film war damals Musik für die Augen.
Denken wir einen Augenblick an La Passion de Jeanne d’Arc von Dreyer, an das halluzinatorische Tempo der Folge der Bildeinstellungen, an die plastische Ausgewogenheit der Nahaufnahmen, dies alles im Dienste einer ganz inneren Passion. Und man sieht ein, wie stark im Tonfilm die Beherrschung der Bildsprache nach und nach verloren gegangen ist. Erinnern wir uns auch an Wind von Sjöström, nicht nur an die Allegorie des in den Wolken stampfenden weissen Pferdes, sondern auch an die Bewegungen, die Haltungen, die Blicke der Schauspieler, die mit expressiver Ausdruckskraft ohnegleichen die Intensität der erlebten Gefühle wiedergeben. Und man versteht, wie stark die Geste, der Blick hinter dem Wort verschwunden sind.
Die wirkliche Emotion entsteht weit mehr durch die Formgebung als durch das Erzählte. „Das innige Zusammenspiel der Bilder soll diese mit Emotion füllen“, sagt Robert Bresson.
Beim Wiedersehen von Das Schweigen realisiert man noch heute, wie stark die Bilder im Film von der Inszenierung geprägt werden, d. h. von den Entscheidungen, die bei der Organisation aller konstitutiven Elemente des Films im Hinblick auf die Handlung den Ausschlag geben. Denn ein Filmbild kann nicht isoliert betrachtet werden. Es ergibt sich aus der Bestimmung des visuellen und akustischen Raumes, aus der Zeit, aus den Bewegungen, die sich in diesem Raum und in dieser Zeit abspielen. Und das Bild erhält schliesslich seinen wirklichen Sinn nur im fliessenden Ablauf, im globalen Rhythmus des Films.
In L ‚Argent von Bresson habe ich die brutalste Ohrfeige der Filmgeschichte erlebt. Ein Mann nähert sich einer Frau, die in ihren Händen eine Kaffeeschale hält. Aber man sieht die Ohrfeige nicht; man hört sie nur „off“. Und was man in diesem Augenblick sieht, ist das Zittern der Kaffeeschale in den Händen der Frau, und wie die Flüssigkeit sich heftig bewegt. So handhabt nur ein grosser Regisseur den filmischen Raum und die dem Film eigene Suggestivkraft: erzeigt nicht nur, sondern er verbirgt auch; er lässt so der Einbildungskraft Raum und der Fiktion die Möglichkeit, sich mit Emotion zu füllen.
Zu dieser Einstellung sagt Bresson noch: „Alles zeigen wollen führt den Film zum Klischee, zwingt ihn, die Dinge zu zeigen, wie alle gewohnt sind, sie zu sehen. Das Fragementieren ist unerlässlich, will man nicht einfach reproduzieren. Die Menschen und die Dinge in ihren abspaltbaren Seiten sehen. Diese Teile isolieren, um ihnen eine neue Abhängigkeit zu geben.“
Der Bildkram, der unsere Bildschirme überschwemmt, ist auf seine Art eine oberflächliche Spiegelung unserer äusseren Unruhe. Er zeigt das Aeussere, um besser das Innere zu ignorieren.
Es wird dringend, das Bild aufzuwerten, ihm eine Tiefe hinter seiner glatten Oberfläche zu geben. Es ist ebenfalls dringend, nicht die Dinge in der Wirklichkeit zu privilegieren, sondern den Geist in den Dingen und hinter den Dingen. Und dieses Unternehmen kann nicht die Sache von mehr oder weniger glänzenden Aestheten sein. Es kann nur von Autoren in Angriff genommen werden, die genau und ehrlich eine innere Wahrheit auszudrücken suchen.
Heutzutage subversive Filme drehen heisst: Bilder schaffen, die jenseits der Mode sind, weil sie direkt auf das Sein hinweisen; seine eigene Beziehung zur Welt klären versuchen, um das Sein in der Vielfalt wiederzufinden.
Ich schlage folgende Gleichung des Films vor: fabrizierte Bilder + eine innere Wahrheit = eine authentische Emotion.