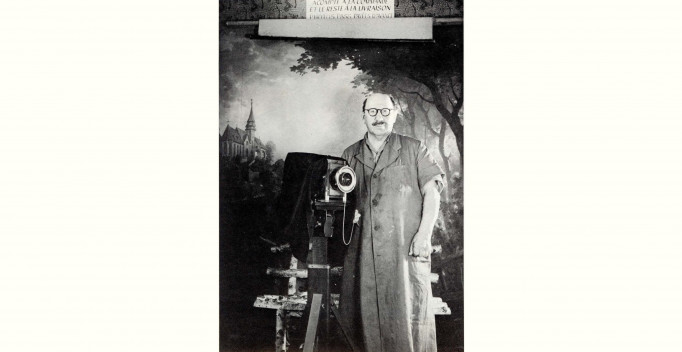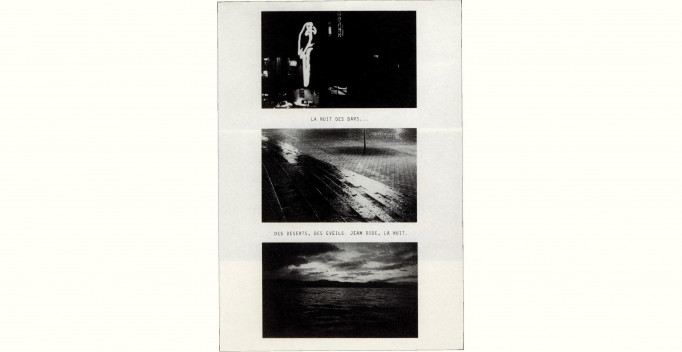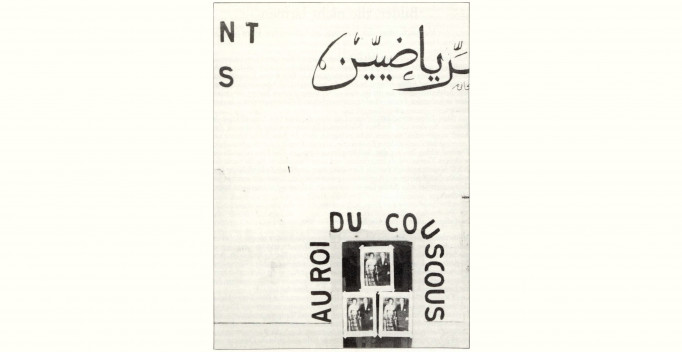Fotografie und Film: welch schönes Thema! Weit und voll von Luftzügen wie eine Zirkuskuppel. Jonglieren wir mit Ideen, und wir werden bestimmt im Scheinwerferlicht die Verwandtschaften und Aehnlichkeiten der stehenden und der bewegten Bilder finden. Die optischen Illusionen sind grenzenlos.
Und wenn wir eher von dem Graben, der die beiden Medien trennt, sprächen? Obwohl sie von den gleichen Linsen auf die selbe Art von Filmmaterial fixiert werden, eröffnen das isolierte Bild und jenes, das vierundzwanzigmal pro Sekunde vervielfältigt wird, zwei völlig verschiedene Welten. Es gibt gewisse Berührungsstellen, aber sie sind fein und wechselhaft. Und sei’s nur auf der Ebene der Personen. Dieser Text, der auf der Grundlage eines Round table-Gesprächs zwischen Fotografen, Filmautoren und Journalisten1 verfasst wurde, ruft zuerst nach einer Vorbemerkung: In der Westschweiz ignorieren sich, von einigen Ausnahmen abgesehen, die verschiedenen Bilderberufe in grossartiger Weise; die Abkapselung regiert. Eine vielsagende Anekdote dazu: Wenn ein Journalist bei einem Filmemacher für seinen Artikel um ein Foto von den Dreharbeiten bittet, bekommt er in neun von zehn Fällen ein Rechteck von neun auf zwölf Zentimetern, auf dem man von hinten und unscharf den Regisseur errät oder den Hauptdarsteller in irgendwelcher nebligen Umgebung. Gleichgültigkeit.
Dieser Sachverhalt erstaunt, weil man sich, schon aus historischen Gründen, einen viel lebhafteren Austausch zwischen Film und Fotografie vorstellen könnte. Die historischen Bedingungen haben es anders gewollt. Anstatt das Thema Fotografie und Film theoretisch anzupacken, skizziert der folgende Aufsatz die Umstände dieses verpassten Rendez-vous und einige Perspektiven auf eine möglicherweise nahe Zukunft.
Vevey, welch ein Niedergang
Sechziger Jahre. Das Fernsehen stammelt, der Westschweizer Film existiert praktisch nicht oder nicht mehr. Wer von Bildern träumt, von grossen Reportagen und von Inszenierungen, muss nach Vevey, an die Schule für Fotografie, pilgern: Ein Mythos, den Gertrud Fehr geschaffen hat, das non plus ultra schöner fotografischer Arbeit. Weil es keine Filmschule weit und breit gibt, schreiben sich auch passionierte Filmliebhaber ein, ermuntert von ihren Lieben, die annehmen, sie würden wenigstens „ihr Leben verdienen“ lernen. Zudem ist Vevey obligatorische Durchgangsstation für künftige Fernsehkameramänner. Kurz, der berühmte einzige Eingang.
Doch der Mythos ist in die Jahre gekommen. Rekrutenschule ebensosehr wie Fotografenschule, ist Vevey ein perfekter Reflex jener Jahre in der Schweiz: Man perpetuiert in kalter technischer Perfektion die Klischees eines konformistischen, nur leicht bitter gewordenen L andes. Geschleckte Ausleuchtung von Luxusuhren; keine Oeffnung auf die Welt.
Da sind sie fast alle auf dieser Galeere: Künftige Filmemacher wie Francis Reusser, Yves Yersin, Simon Edelstein, Jürg Hassler, Yvan Dalain, Yvan Butler, Simone Mohr, André Gazut. Künftige Kameraleute wie Jean Zeller, Jacques Cavussin, Roger Bimpage. Der spätere Produzent Yves Peyrot. Schicken wir es gleich voraus: wenige von ihnen werden in der Ehrenliste der Direktion geführt; ein guter Teil von ihnen verlässt die Schule vor dem Abschluss; zum Teil sind’s starke Abgänge. Stellen wir uns nur Francis Reusser vor, der das Palästinapro- blem entdeckt, eine echte Revolution, die seine Wahrnehmung der Welt total verändert. Er macht darüber — zusammen mit Armand Dériaz, einem weiteren Absolventen von Vevey — den Film Biladi2, der 1970, als er am Festival von Locarno uraufgeführt wurde, von der Neuen Zürcher Zeitung als „kriminell“ bezeichnet wurde. Simon Edelstein seinerseits bringt aus arabischen Ländern eine Serie von Fotografien nachhause, die der Atlas des Voyages veröffentlichen wird; sie verachten Exotismus und Ethnologie und unterstreichen das Chaos einer Region im dauernden Ungleichgewicht. Yersin hingegen denkt bereits nicht mehr an die Fotografie, die er doch schon seit seinem 13. Lebensjahr im dörflichen Atelier eines Fotografen in der Gegen von Nyon ausgeübt hat. Die Filme von Alain Resnais haben ihm den Atem verschlagen, und er beschliesst, dass es „das ist, was man machen muss“.
Der wahre Elan dieser Leute rennt sich an einer Mauer von Routine den Kopf blutig. Die Schule von Vevey verkörpert für die jungen enthusiastischen und engagierten Menschen schliesslich alles, was sie an der Schweiz der Hochkonjunktur hassen. Die Fotografie selbst bleibt nicht verschont vom Zusammenstoss mit der Tradition. Zurück aus Kuba, denunziert Luc Chessex die langweilige Einheitlichkeit der Städte, die in Reih und Glied aufgehängten galonnierten Offiziersmützen, die Spiegelungen des Matterhorns in Bankschaufenstern. Er zeigt seine Bilder unter dem Titel „Wir wollen nicht eine Welt, in der die Garantie, nicht Hungers zu sterben, sich einhandeln lässt gegen das Risiko, vor Langeweile zu sterben“.3 Während Chessex seinen kritischen Blick zuspitzt, aber der Fotografie treu bleibt, stellen andere den Akt des Fotografierens selbst in Frage, die Beziehung mit den Personen, die der Fotograf „schiesst“. Unwohl in der Haut des ewigen Zeugen, behindert durch den starren Rahmen des Einzelbildes, driften sie gegen das kollektive Abenteuer Film mit seiner Möglichkeit, in den Rahmen zu treten, eine Erfindung zu entwickeln und eine eigene, persönliche Sprache zu führen. Sie werden dazu ermuntert durch den Niedergang der grossen fotografischen Reportage. „Die Konjunktur machte den Beruf schwierig“, sagt Simon Edelstein, „um zu überleben, musste man opportunistisch oder charismatisch sein.“ Er trat als Kameramann beim Fernsehen ein.
Der Aufbruch ist generell. In dieser Schlüssel-Periode des Beginns eines Films in der französischen Schweiz ist die Beziehung zwischen Film und Fotografie eher gespannt. In der Gestalt der Fotoschule Vevey ist letztere ein eigentlicher Gegner; sie symbolisiert den traditionellen Ausdruck der Schweiz, den sich die jungen Realisatoren zu demythifizieren vorgenommen haben. Selten sind die Fotografen wie Chessex, Jean Mohr oder Armand Deriaz, die einen anderen Blick anbieten; überdies sind die Kanäle, die ihre Produktion zum grossen Publikum fliessen lassen könnten, immer weniger effizient. Der junge Film der Westschweiz wird von dem Wunsch getragen, mit dem wurmstichigen Klassizismus von Vevey zu brechen und den Inhalt gegen eine kompromittierte Form — sie hat alle und alles verherrlicht — in Schutz zu nehmen.
Tanner und Berta
Alain Tanners Stil trifft ins Schwarze. La Salamandre triumphiert in den Pariser Kinos und lässt — sozusagen als Abpraller — die Westschweiz wissen, dass es da einen eigenen Film gibt, getragen von der „Bande der Fünf“4.
Vor allem Tanner wendet die Regeln des cinema direct konsequent an, lehnt den Eingriff ins Bild und in den Originalton strikte ab. Die Künstlichkeit der Aufnahmen wie Schuss und Gegenschuss widern ihn an, eine möglichst natürliche Ausleuchtung genügt ihm. Im Grunde ist ihm das Bild an sich eher gleichgültig; die fotografische Annäherung ist zweitrangig, die Fotografie bescheidene Dienerin des Stoffes. Das Drehbuch baut Tanner um Hauptideen; da schreibt der Filmemacher ganze Notizbücher voll, er sucht, er investiert in dem Dialog. Nur ein ganz schlauer Kopf könnte sich den kommenden Film vorstellen, wenn er Drehbuch und Notizen läse.
Und die anderen? Michel Soutter pflegt die Atmosphäre, die kleine Musik, aber er treibt das Bild nicht sehr weit. Er improvisiert in einer Art musikalischer Sensibilität mit den Bildern, die ihm der Augenblick gerade bietet. Was Claude Goretta betrifft: er ist deutlich literarischer. Vereinfachungen, zugegeben. Aber der Westschweizer Film, der sich am Ende der sechziger Jahre manifestiert und sich in den ersten Jahren des folgenden Jahrzehnts bestätigt, trägt die Zeichen eines zerebralen Vorgehens. Es setzt auseinander und weist nach, mehr als dass es zeigt und erzählt. Das absichtsvoll flache Bild unterstreicht die eintönigen Stadtlandschaften, den Triumph des schlechten Geschmacks, die nicht sehr einladenden Kulissen des Wohlstands, dessen Lob die Mächtigen singen. Die lächerliche Kleinheit der Budgets diktiert ebenso die Armut der Mittel.
Das Finanzierungsproblem ist so oft abgehandelt worden, dass man hier nur daran erinnern darf. Die ökonomischen Sorgen schlagen sich in doppelter Weise nieder: zuerst in der Zuflucht zu beschränkten Mitteln und Stoffen; dann in der Aengstlichkeit der Realisatoren, die verdammt sind, jedesmal alles zu sagen. Die Herstellung eines Spielfilms bleibt eine derartige Seltenheit, dass sich ein Realisator mit Haut und Haaren hineinwirft, mit einemmale, wie wenn alles in diesem einzelnen Werk ausgedrückt sein müsste. Eine zu lange zurückgehaltene Rede, sich überstürzende und gar widersprechende Ideen in einem nicht immer gemeisterten Schwall. Auch deshalb kommt es gar nicht in Frage, dass einer „sich zufriedengibt“ mit einer Geschichte und schönen Aufnahmen.
Letzter wichtiger Punkt: Die Mehrzahl der Filmemacher kommt vom Fernsehen, dem einzigen Produzenten, der über Mittel verfügt und eine einigermassen regelmässige Arbeit garantieren kann. Aber die Stärke des Westschweizer Fernsehens liegt in der aktuellen Reportage, und jene, die beim Fernsehen ihre Sporen abverdienen, lernen zuallererst, sich der Kamera unauffällig, sauber und direkt zu bedienen.
So also formt sich ein schmuckloser Stil, in dem sich die materielle Beschränkung mit den moralischen Restriktionen und dem Willen zum politischen Bruch finden. „In diesem Moment ist der Westschweizer Film an der Grenze der Verachtung des Bildes“, meint Simone Mohr.
Mit der Zeit und den ersten Erfolgen entwickeln sich allerdings die materiellen Möglichkeiten. Von 100’000 Franken steigen die Budgets der Filme auf eine Million und darüber. Das Feld ist bereit für den Aufbruch des „Phänomens Berta“, das auf die Westschweizer Produktion einwirkt ohne freilich das grundlegende Credo umzustürzen. Renato Berta setzt sich Mitte der siebziger Jahre durch mit der Sicherheit seines Blicks und mit seiner Sensibilität für das Licht. Immer öfter ist er hinter der Kamera. Weil er mit Leuten arbeitet, die, was das Bild betrifft, eigentlich keine präzisen, formulierten und kohärenten Ansprüche stellen, übernimmt er die Macht fast gegen seinen Willen. Das tut den Realisatoren allerdings gar nicht weh, denn sie kommen selber auf den Geschmack. Nach den Jahren der Revolte kommen — mit einem bitteren Nachgeschmack im Mund — jene des Umschlags, des Rückzugs auf sich selbst. Während die Gesten langsamer werden und fast einfrieren, dreht sich der Diskurs um das Ich, färbt sich nostalgisch und/oder bewegt sich auf eine neue Metaphysik der Verzweiflung zu. Eine gewisse Aesthetisierung kommt wieder auf. Aber Achtung, nicht jene der stolzen, triumphierenden Schweiz, vielmehr jene intimistische, fast phantomhafte der verlorenen Höfe der weichen Linien des Jura. Oder Irlands. Die Kamera verharrt auf Gesichts- und Körperausdrücken, sie scheint in den Landschaften das Bild des systematischen Zerfalls oder den Schlüssel für diese bis ins Mark kranke Welt zu suchen. Das Bild streift manchmal den Akademismus. Aber hinter Bertas Manier beherrschen immer noch die Themen das Feld... und sie geraten äusser Atem. Kaum ist die Bestätigung da, durchlebt der Westschweizer Film, das schwierige Kind, eine melancholische Pubertät.
Begegnungen
Die oben beschriebene Entwicklung ist nicht gleichförmig. Innerhalb des Mikrokosmos verfeinern die individuellen Optionen die Wirklichkeit, und unter ihnen lohnt es sich, auf jene einzugehen, die — in einer gegenläufigen Bewegung — Fotografie und Film sich begegnen lassen.
Zunächst einmal geschieht es nicht nur einmal, dass in Westschweizer Filmen fotografiert wird. Nicht zufällig. Denken wir an Pipe, der in Les petites jugues die Sofortbildkamera entdeckt oder der das Bild des Matterhorns über seinem Bett betrachtet, bevor er es im Helikopter umfliegt, diesen „Haufen Steine“: Hier hält die Fotografie das Drehbuch in Bewegung; ihre lügnerische Magie, aber auch ihre distanzierte Wahrnehmung der Welt löst einen Bewusstseinsprozess aus.
Ein anderer Vorgang: Eine Sammlung von Fotografien kann das Material für einen Film abgeben. Claude Champion hat zwei solche Filme gemacht: Quand il n’y a plus d’Eldorado mit den Südamerika-Bildern von Luc Chessex und Marie Besson, wo Champion die grossartigen Archive der Waadtländischen Fotografendynastie Dériaz benützte. Während Jahrzehnten hatten die Deriaz Szenen aus dem ländlichen und dörflichen Leben am Fusse des Jura auf ihren Platten festgehalten. Es sind einzigartige, dichte Dokumente, die die Arbeit und die Musse, die friedliche Landschaft und das Geheimnis von Gruppen festhalten, wo ein ungeduldiges Kind auf der Gelatineplatte ein unscharfer Wirbel wird. Jedes Bild spricht in solcher Weise zu uns, aber Champion überlagert die Fotografien mit einer zweiten Geschichte und verschränkt sie mit der bereits erzählten. Entdecker, Ethnologe und Aesthet, der er ist, fühlt er sich in seinem Stoff äusserst wohl. „Bei dieser Arbeit habe ich gelernt, dass das Standbild das Wesentliche von dem festhält, was das Filmbild auf lebendige Art mitteilt. Wenn man diese isolierten Bilder nebeneinander stellt, bewegen sie die Phantasie. Ich befürchtete, dass das Resultat streng und trocken ausfallen könnte; es war nicht der Fall.“
So einleuchtend solche Versuche auch sind, leicht liessen sich Verbreitungskanäle nicht finden. Das Westschweizer Fernsehen nahm sich Zeit mit seinem Interesse an Marie Besson, gelähmt wie es als Neureicher war, der deklarierte, dass nur das „Bild, das sich bewegt“ den Zuschauer interessiere. Die Beweise des Gegenteils allerdings häuften sich. Simone Mohr brauchte den Tricktisch für ihr Porträt von Arnold Kübler. Ihr Mann, Jean Mohr, verkaufte eine Reportage über Bauern in der Haute-Savoie an . . . die BBC in London. Und dann, jenseits der Grenze, erprobte das französische Fernsehen systematisch den Gebrauch der Fotografie, zuerst mit der Sendung Une minute pour une image und kürzlich erst in einer vielversprechenden Reihe mit dem Titel Contacts, wo sich die Filmkamera wie eine Lupe auf den Kontaktbogen grosser Fotografen bewegt, während diese im Off auseinandersetzen, wie sie sich mit ihrem Thema befasst haben bis zu der entscheidenden Aufnahme.
In einem Abschnitt mit der Ueberschrift „Begegnungen“ bekommt das Experiment der Communauté d’Action pour le Développement de l’information Audiovisuelle (CADIA) einen besonderen Stellenwert. Der Journalist Charles-Henri Favrod führte es im Rahmen der Editions Rencontre (Begegnung) durch. Als leidenschaftlicher Partisan der Fotografie, immer mit der Nase im Wind, gibt Favrod den jungen Rebellen eine Chance im Rahmen der Reihe „Buch der Reisen“ eine Chance zur Profilierung ihrer Persönlichkeit. Aber er hat noch weitere Perspektiven. Er sieht die Verbreitung der Videokassette voraus, die Antwort auf das sich konsolidierende Monopol der Fernsehanstalten. Die grossen Illustrierten sind tot, aber gäbe es nicht einen anderen Platz für die jungen Abenteurer der Film- oder Videokamera? CADIA will mit jenen Zusammenarbeiten, die ihre Filmkamera als Notizbuch benutzen, und die ihre Notizen in eine erarbeitete, strukturierte Form bringen möchten. Die private Unternehmung profiliert sich mit einem Meisterwerk: Marcel Ophuls’ Le chagrin et la pitié, einem Film, der ohne Kompromisse die Haltung der Franzosen während der Okkupation untersucht. Zu gewagt: Frankreich hat die Dämonen der Vergangenheit noch nicht bewältigt, und das Fernsehen verweigert während langer Zeit die Ausstrahlung des film maudit; es fürchtet Sanktionen der — falschen und echten — Widerstandskämpfer. Die Schweiz ihrerseits gibt dem Film nicht das schweizerische Ursprungszeugnis: der Stoff ist nicht schweizerisch, und der Autor hat drei Pässe: dass der Produzent Westschweizer ist, hilft da nichts. CADIA versucht, die Westschweizer Verlage zu interessieren, aber die vergessen Favrods Dossier in Schubladen oder unter einem Haufen von Manuskripten. Vielleicht war die Unternehmung etwas verfrüht; das Experiment CADIA wird jedenfalls abgebrochen. Aber es hinterlässt doch eine Spur: eine Gruppe von Angefressenen „erbt“ den technischen Apparat und nennt sich Film et Video Collectif arbeitet noch immer in Ecublens: eine kleine Produktionsinfrastruktur für die weniger kommerziellen Projekte in der Westschweiz. CADIA bleibt aber der wichtigste Versuch in der Westschweiz, Bildermacher — d.h. Fotografen und Cineasten — zu vereinigen und zu fördern.
Erneut die Alpen
Die Versuche von Favrod haben nicht den Erfolg, den sie verdienen würden, beweisen aber, obwohl sie von oben herab beurteilt und ausgeschaltet werden, immerhin, dass es in der Westschweiz eine fotografische Kultur gibt, die explodieren könnte, nicht zuletzt im Film. Eine Kultur, die bis in die fünfziger Jahre, als sie in der Konsumgüterwerbung ertrank, immer wieder hervorragende Persönlichkeiten hervorgebracht hat. In der Tat sind die Romands Bildermenschen. Man muss nur historisch zurückblicken, um zu sehen, mit welcher Schnelligkeit sie bei den Anfängen der Fotografie dabei waren. Einer hätte Daguerre und Talbot um Haaresbreite gar das Patent für das erste fotografische Verfahren entrissen. Sofort entstanden Ateliers, die weitherum berühmt wurden (Boissonas, Deriaz, De Jongh), und Amateure stürzten sich auf die Erfindung. Kurz, diese Region erlernte die Fotografie, wie wenn diese genau für sie erfunden worden wäre. Anders verhielt es sich beim Film, wo man jahrzehntelang warten musste.5 Als sich die Westschweiz auch diesem Medium, das ja doch vom technischen Prozess her gesehen mit der Fotografie verwandt war, massiv zuwandte, geschah dies mit einer Art schlechtem calvinistischem Gewissen. Es wäre interessant, sich gründliche Gedanken zu dieser Verzögerung zu machen. Wagen wir eine Hypothese: Die Westschweizer haben ein eher kontemplatives Temperament und ein irgendwie mystisches Verständnis des Bildes. Sie verheddern sich rasch, wenn es darum geht, mit Bildern Geschichten zu erzählen6 oder einen Diskurs zu führen. Die innerlichen Wellen in ihnen haben Mühe, an die Oberfläche einer überzeugenden visuellen Sprache zu steigen. Wenn das Gespräch zwischen Fotografie und Film schwierig erscheint, dann ist es weniger wegen der gegenseitigen Gleichgültigkeit, sondern mehr wegen der Probleme mit dem Erzählen. Sagen wir einmal, der Romand sei noch immer auf der Suche nach einer visuellen Syntax für seine Gefühle. Diese Suche wird selbstredend immer wieder gestört durch die Bewegungen des Films ausserhalb der Grenzen. Der Westschweizer Film, lange Zeit unter dem Einfluss des „Mai 1968“, wird zur Zeit durch „amerikanische Muster“ in Frage gestellt: durch Filme mit klarer Zielsetzung, entschlossen geplante und mit der selben Entschlossenheit realisierte Filme, effiziente, und gar nicht unbedingt nur gefällige Filme, die obendrein beim Publikum gute Aufnahme finden.
Besser strukturierte Dramaturgie und genaue Ansprüche: das ist die aktuelle Herausforderung der Westschweizer Filmautoren. Diese Entwicklung ruft nach einem überlegteren Gebrauch der Fotografie. Sehr einleuchtend, was Yves Yersin dazu meint: „Ich ziehe Kameramänner, die ihre Wünsche formulieren können, vor und fürchte Leute, die ein instinktives Bild machen, über alles.“ Die Originalität der Filme der achtziger Jahre wird vielleicht weniger in der Themenwahl als in der professionellen Art ihrer Behandlung liegen.
Einige Indizien legen diese Vermutung nahe. Wir müssen hier einen Namen nennen, den wir bis jetzt absichtlich beiseite gelassen haben: Francis Reusser. Dieser Filmemacher ist wohl am meisten mit dem Bildermachen beschäftigt; für ihn steht das Bild immer im Vordergrund. Erführt seine fotografische Tätigkeit ununterbrochen weiter; wenn er seine Projekte erklären soll, tut er es ebensosehr mit Zeigen wie mit Erklären. Spots, Inserate, alltägliche Aufnahmen und Zeichen, alles Bildhafte überrascht ihn, fordert ihn heraus. Er ist vielleicht der einzige, der wirklich visuelle Projekte zu entwerfen vermag.
Im Herbst 1984 realisiert Francis Reusser Derborence. Aufgepasst. Die Wahl des Stoffes und der Landschaft setzt ein Zeichen. Vor zehn Jahren wäre der Stoff wohl noch unmöglich gewesen. Seinen Oedipuskomplex auslebend, kehrte der W’estschweizer Film den Klassikern der Westschweizer Literatur den Rücken zu, ebenso den Orten, die eine gewisse Schweiz symbolisierten. (Es gab Ausnahmen, sicher — Goretta mit Jean-Luc persécuté, Jean Marc Bory —, aber wir vergessen sie). Nun ist der Westschweizer Film erwachsen geworden. Derborence ist ein lyrischer Stoff, wie gemacht für Reusser. Natürlich ist das Experiment gefährlich für den Realisator. Auf der einen Seite droht der Verrat, auf der anderen drohen die Klischees. Der Weg zu der tiefen Magie des Werks, zu seiner wesentlichen Identität ist schmal.
Francis Reusser steht nicht allein. Pierre Koralnik hat einen Telefilm nach Rainuz (Le Rapt) fertiggestellt; Etienne Delessert ist mit anderen Mitteln in die selbe Region hinaufgestiegen (Supersaxo), Marcel Schüpbachs L ‘Allégement war ein Vorbote, und in der deutschen Schweiz knüpft Fredi M. Murer (in Höhenfeuer) an der gleichen Stelle an. Nachdem sich der Westschweizer Film (und nicht nur er) an die Randfiguren gehalten hat und durch sie hindurch das Unbehagen und die Nöte der Schweiz der Gegenwart formuliert hat, scheinen sich die Filmer nun für eine tiefere Identität eines Landes zu interessieren, das weder Führern noch der Opposition etwas verdenkt. Eine neue Bilderwelt ist zu schaffen. Die Vorgängerin dieser Welt, geboren aus dem romantischen Geist des 19. Jahrhunderts, von Engländern und anderen Touristen aus der Taufe gehoben, lebt im Ausland munter weiter, während sie bei uns Gleichgültigkeit oder Ekel hervorgerufen hat. Wäre vielleicht der Film das Werkzeug einer Erneuerung? Eine schöne Herausforderung.