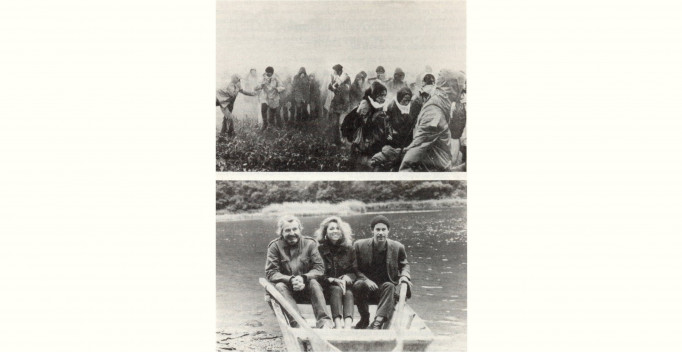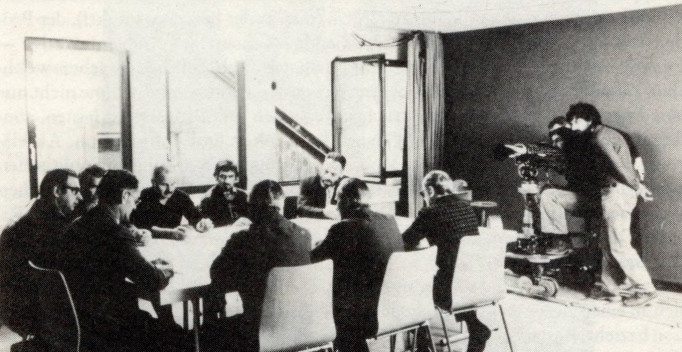28. Juni. Ich befand mich in einem Labyrinth von Treppen. Dieses Labyrinth war nicht an allen Stellen gedeckt. Ich stieg; andere Treppen führten in die Tiefe. Auf einem Treppenabsatz nahm ich wahr, dass ich auf einem Gipfel zu stehen gekommen war. Ein weiter Blick über alle Lande tat sich da auf. Ich sah andere auf anderen Gipfeln stehen. Einer von diesen anderen wurde plötzlich von Schwindel ergriffen und stürzte herab. Dieser Schwindel griff um sich; andere Menschen stürzten von anderen Gipfeln nun in die Tiefe. Als auch ich von diesem Gefühl ergriffen wurde, erwachte ich.
Walter Benjamin: Gespräche mit Brecht, Svendborger Notizen, 1938
Initiert und mitgetragen durch die weltweit gleichzeitig auftretenden Revolten der späten sechziger Jahre bildete sich in den siebziger Jahren in der Deutschschweiz die schmale Spur des politischen Interventionsfilms aus, die, was das Filmschaffen im Unterschied zu Video anbelangt, in den frühen achziger Jahren sich im Sand der Kino-Produktionen verlor. Ein Nachzeichnen dieser Entwicklung und deren Befragung aus heutiger Zeit sollen nicht Nostalgie eines „Alt-68ers“ widerspiegeln, sondern in den Fragestellungen begründet sein, die das gegenwärtige Schweizer Filmschaffen aufwirft: Fragestellungen, die unmittelbar mit der Tatsache verbunden sind, dass es heute den politischen Interventionsfilm nicht mehr gibt. Viele (Schweizer) Filme, die wir im Kino und/oder TV sehen können, vermögen uns kaum mehr zu bewegen, führen kaum zu Reaktionen und Stellungnahmen: ihre Notwendigkeit ist ihnen abhanden gekommen. Ihre Legitimationskrise, hinter der sich die Ratlosigkeit bezüglich der Funktionsbestimmung des Filmemachens verbirgt, manifestiert sich u.a. in der Orientierungslosigkeit der Autoren, der Beliebigkeit der Film-Stoffe und der fehlenden Drehbuch-Kultur in unserem Lande: die Häufung der Literaturverfilmungen ist dafür nur ein Symptom. Die produktive Kraft des Interventionsfilmes zeigt sich aus heutiger Sicht in dem Versuch, dieses Vakuum zu überwinden; ihr Scheitern (?) beweist, wie ich meine, nicht, dass sie „falsch“ war und ist. Damit ist das Thema dieses Aufsatzes gegeben.
Wir haben in CINEMA die Jahre hindurch kontinuierlich die Diskussion zum Interventionsfilm geführt. Bei der erneuten Lektüre der einzelnen Beiträge können wir feststellen, dass die Fragen nichts an Aktualität verloren haben. Mit den Antworten, die zu geben versucht wurden — auch in den Filmen selbst — liegt es nicht so eindeutig. Deshalb soll eingangs ein kurzer Ueberblick über die verschiedenen Filme stehen, mit dem Risiko, dass einiges bekannt, in der Gewissheit aber, dass vieles verschüttet, wenn nicht gar vergessen ist. Vollständigkeit ist nicht beansprucht, die Beispiele stellen eine Auswahl dar.
Kaiseraugst (Kollektiv der Filmcooperative Zürich, 1975) ist ein spontan, mit geringen Mitteln (13’000 Franken) entstandenes, aus der Situation gedrehtes Dokument der Besetzung des Geländes des geplanten Atomkraftwerkes in Kaiseraugst. Die Diskussion über die Atomkraftwerke tritt in dieser Filmarbeit in den Hintergrund: primär ist die Absicht, gegen die breite und gezielte öffentliche Kriminalisierung der Besetzer und ihrer direkten politischen Aktion Gegeninformationen zu liefern. Bestimmend ist dabei nicht ein theoretischer Ansatz, sondern eine „moralisch“ motivierte Beweisführung vor Ort. Das Filmteam leiht den Besetzern das Mikrophon, damit diese ihren Erfahrungen und Anliegen unmittelbar Ausdruck geben können. Die Kamera hält die Interviewten fest und vermittelt Stimmungsbilder aus dem besetzten Gebiet. Die Montage addiert die Einstellungen zu einem Puzzle von Eindrücken — einzig am Schluß des Films erhält sie eine Art agitatorische Dynamik, indem in schneller Abfolge dem Bauplatz von Kaiseraugst wiederholt der Kühlturm des Atomkraftwerkes von Gösgen gegenübergestellt wird. Die Form des Film ist dem journalistischen Erlebnisbericht verpflichtet. Die Filmemacher verstehen sich als Teil einer aktiven Bewegung, ihre Leistung ist es, ohne sich finanziell abzusichern, schnell zu reagieren, an Ort zu sein, Stimmen einzufangen, Bilder zu machen — präsent zu sein und ein Ereignis als Vorgang zu dokumentieren. Darin liegt aber auch die Begrenzung dieses 25 minütigen Filmdokuments. „Die Erfahrungen während der Besetzung führen über die Problematik der Atomkraftwerke hinaus, und wir meinen, dass darum die Besetzung von Kaiseraugst in einem umfassenden politischen Sinn von Bedeutung ist.“ Diese Meinung der Autoren ist sicher richtig, und sie wird durch die Statements der befragten Besetzter untermauert — im Film jedoch kommt sie weder in bezug auf die ästhetische Gestaltung noch den konzeptuellen Aufbau zum tragen. In dieser Hinsicht geht ein Film der drei Jahre später weiter:
Gösgen — ein Film über die Volksbewegung gegen Atomkraftwerke (Jürg Hassler, Donatello und Fosco Dubini, 1978). Was Kaiseraugst ansatzweise — durch Verweise auf andere Atomkraftwerke und die Geschichte von Kaiseraugst — versucht, wird hier ausgebaut: Gösgen ist eine filmische Langzeitbeobachtung (über ein Jahr, Kaiseraugst zehn Wochen) des Kampfs der Bevölkerung gegen das Atomkraftwerk Gösgen-Däniken. In einem ersten Teil werden der Widerstand der Bevölkerung mit den offiziellen politischen Mitteln und das Vorgehen der Atomlobby nachgezeichnet, in einem zweiten die Phase der grossen Demonstrationen (Pfingstmarsch 1977), der Besetzungsversuche sowie des Protesthungerstreiks gegen die Einführung der Bundessicherheitspolizei. Auch dieser Streifen wird mit wenig Geld hergestellt, meist mit Super-8 gedreht und aufgeblasen. Das Material ist komplexer, die filmische Erarbeitung vielschichtiger, der Film als Ganzes ergibt ein reiches Bezugsfeld, in dem Individuelles und Kollektives, Gegenwart und Historie ineinandergreifen, ohne dass aber auch hier ein formal übergreifendes Konzept dem Werk eine eigenständige Struktur verleiht und damit eine der Funktion des Films entsprechende Bildsprache entwickelt wird. Wilhelm Roth nennt in seinem überzeugenden Buch zum Dokumentarfilm (Der Dokumentarfilm seit 1960, München/Luzern 1982) diese Arbeiten „Seismographen“: „Sie reagieren recht genau auf die jeweiligen politischen Umstände. (...) Keiner dieser Streifen besticht durch eine besondere filmische Qualität, dennoch gehören sie zu den wichtigsten der siebziger Jahre: Sie hatten eine Funktion, sie haben Menschen mobilisiert, in ihrem Widerstand bestärkt ...“ (S. 100 f.) Gösgen hat wie Kaiseraugst die Mechanismen der politischen Oeffentlichkeit der Schweiz zum Thema und dabei vor allem die (Wieder-)Belebung der direktdemokratischen Praxis auf dem Hintergrund eines Ohnmacht Gefühls des Bürgers in der Vertretung seiner vitalen Interessen den „granitenen Kräften von Behörden und Wirtschaft“ gegenüber.
Jüngstes Beispiel des Bürgerinitiativen-Films im Schweizer Filmschaffen ist Rothenthurm (1984, vgl. „Index“). Der Untertitel lautet: „Bei uns regiert noch das Volk“. Der Film liefert nicht primär eine kritische Analyse der politischen, wirtschaftlichen und strategischen Bedeutung des geplanten Waffenplatzes, sondern Impressionen aus dem Widerstand der Betroffenen, dem bäuerlichen Alltag und Bilder vom jahreszeitlichen Wandel der unberührten, einzig landwirtschaftlich kultivierten Natur. Rothenthurm ist ein Film auch über Heimat. „Von den veröffentlichten geschriebenen und gefilmten (TV) Sachen gehen alle aufs Faktische, Informative aus. Mit dem Film will ich dagegen Stimmung vermitteln, Gefühle und Verhaltensweisen dokumentieren: statt Fakten also die bestimmenden Emotionen, statt Sachprobleme die Menschen.“ So der Autor Edwin Beeler. „Von sachgerechter Aufklärung kann da nicht die Rede sein“, stellt denn auch Redaktor Ernst Herzig aus einer ideologisch Beeler entgegengesetzten Ecke im Schweizer Soldat/FHD (Unabhängige Monatszeitschrift für Armee und Kader, Januar 1985) fest, und während die NZZ dem „Zeugnis der Gesprächsverweigerung“, wie sie den Film einstuft, „polemische Einseitigkeit“ vorwirft, notiert Herzig konsterniert: „Das ist schon eher Volksdemokratie, was in diesem Film (und in der Wirklichkeit) demonstriert wird.“ Rothenthurm ist in Zusammenhang mit der Initiative gegen den Waffenplatz zu sehen und vertritt die Sache der Opposition. Trotzdem handelt es sich in keiner Hinsicht um einen agitatorischen Film: Er ist weder in die Tradition der Traktat-, noch der Pamphletfilme einzureihen. Vielmehr orientiert sich diese Arbeit an einer Linie, die etwa von Yves Yersins Die letzten Heimposameter (1974) zu Gossliwil (Beatrice Leuthold, Hans Strüm, 1985) führt, der Entwicklung eines ethnologisch sozialkritischen Films. Anzufügen ist jedoch, dass Beeler und sein Team in der Bildsprache und insbesondere dem Filmaufbau nicht annähernd die Innovation der beiden erwähnten Filme erreichen. Die vier Ebenen in Rothenthurm (Die Landschaft — der Bauer Adolf Besmer — die Chronik der Ereignisse — Interviews) werden parallel laufend parataktisch organisiert, sich gegenseitig unterbrechend jeweils wieder aufgenommen und zu einem teppichartigen Gewebe verbunden: Der Film liefert eine „genrehaftes Tableau“. Die verschiedenen Ebenen der Realtität als Vorgang und des Films werden vorgezeigt: die Kamera zeigt Vorhandenes, ohne dass das Zeigen des Gezeigten — mit Ausnahme einer kurzen schwarz/weiß-Einstiegssequenz —, die Filmsprache also, Teil der Reflexion dieser Arbeit wird. Das gibt dem Film etwas Plakatives, das gefüllt und getragen werden soll durch „Stimmung“.
Im Zusammenhang mit Initiativen, Abstimmungen und politischen Bewegungen kleinerer oder größerer Gesellschaftsgruppen auch innerhalb der Instutionen sind im weiteren u.a. folgende Filme entstanden:
Braccia si — uomini no (Peter Ammann, 1970) ist im Vorfeld zur sogenannten Schwarzenbach-Initiative gedreht. In diesem Film dominiert das Wort, Ammann liefert eine breite Palette von Diskussionsbeiträgen der Gegner und Befürworter, ohne durch das filmische Konzept selber explizit Stellung zu nehmen. Die Frage der ausländischen Arbeiter in der Schweiz hat Schweizer Filmemacher wiederholt zu kritischen Arbeiten im Dokumentar- und Spielfilmbereich angeregt, wobei die einzelnen Werke nicht als Interventionsfilme bezeichnet werden können: Cerchiamo per subito operai, offriamo ... (Villi Hermann, 1974), II rovescio della medaglia (Alvaro Bizzarri, 1973), Lo stagionale (Alvaro Bizzarri, 1972), Ritorno a casa und Emmigrazione (Nino acusso, beide 1980), Unsere Eltern haben den Ausweis,C‘ (Eduard Winiger, 1982), Siamo italiani (Alexander J. Seiler, 1964), Sono Emigrata (Getrud Pinkus, Anna Monferdin, 1979), II valore della donne è il suo silenzio (Getrud Pinkus, 1980), Il Treno rosso (Peter Ammann, 1972).
E noialtri Apprendisti (Giovanni Doffini, 1976) stellt eine mit verschiedenen Bildmaterialien lebendig wirkende, in der Endform nicht durchgearbeitete Chronik eines Lehrlingsstreiks in der Gewerbeschule von Trevano dar, der auf die Probleme der Jugendarbeitslosigkeit aufmerksam macht und im Tessin 1975 grosses Aufsehen erregt.
Ein Streik ist keine Sonntagschule (Hans Stürm, Nina Stürm, Mathias Knauer, 16 mm, Farbe und s/w, 58 Min., 1975) liefert eine geraffte Chronik des vierwöchigen Streiks im Juni 1974 in der Bieler Klavierfabrik Burger & Jacobi. Der Film vermittelt die vielen Aspekte des Kampfs: die Beziehung von Schweizer und ausländischen Arbeitern, das Verhältnis zu linken politischen Gruppierungen, das Versagen der Gewerkschaft, der psychische Druck auf den Einzelnen, die Situation der Frauen der Streikenden, die Reaktion der Oeffentlichkeit, etc. Theorie und das Wissen der Filmemacher treten hier in den Hintergrund: „... nicht die Filmer denken über Arbeitskampf nach, sondern von A bis Z die am Streik Beteiligten selber. Die Filmer haben sich ihnen nur zur Verfügung gestellt ...“ Die Endform des Films besticht durch die kluge Montage, die den einzelnen Menschen mit dem Kollektiv, die private Situation mit dem gesellschaftspolitischen Bereich der Arbeit, die verbale Aussage mit dem konkreten Vorgang in Beziehung setzt und die Dramatik und Dynamik des Geschehens streckenweise unmittelbar in den formalen Aufbau einbringt. Der Streif-Film ist denn auch unzählige Male erfolgreich als Diskussions- und Schulungsfilm in Veranstaltungen und Kursen eingesetzt worden. Die Früchte der Arbeit (Alexander J. Seiler, 1977) und speziell Kollegen (Urs Graf u.a., Filmkollektiv Zürich, 1979) sind zwei weitere wichtige Filmbeiträge zu Fragen der Situation des Arbeiters und der Gewerkschaften. Sie stellen die Probleme an einzelnen Fallbeispielen in einen allgemeinen Bezugsrahmen, ohne dass hier ein konkreter Arbeitskampf die „Vorlage“ liefert. In diesem Zusammenhang ist im weiteren auf L’homme et le temps (Alvaro Bizzarri, Marie-Therese Sautebin, 1984) zu verweisen, einen Dokumentar- und Diskussionsfilm zur Krise der Uhrenindustrie an Beispiel der Lage in Biel.
In lockerer Bezugnahme auf die Mitbestimmungsinitiative, die der Christlich Nationale Gewerkschaftsbund lanciert, startet Hans Stürm Mitte der siebziger Jahre ein Filmprojekt zum Thema Mitbestimmung. Die Thematik soll aus praktischen Beispielen aus der Schweiz und dem Ausland (Deutschland, Jugoslawien) und der theoretischen Analyse entwickelt werden. Dabei macht Stürm die Erfahrung, dass es in gewissen Industriezweigen praktisch unmöglich ist, in den Betrieben zu filmen. Der Arbeitgeberverband torpediert das Projekt als Machwerk der Propaganda. Für die Begutachtung zwecks finanzieller Unterstützung schaltet sich das Justizdepartement ein, führt ein Vernehmlassungsverfahren durch, und der Gesamtbundesrat entscheidet letztlich negativ auf Grund der einzig klar negativen Stellungnahme der Arbeitgeber. Da Arbeiten, die nicht primär ereignisorientiert sind, sondern die Fragestellung allgemeiner angehen und die Situation grundlegender ausleuchten, aufwendig sind, ist der Film mit dem bundesrätlichen Entscheid gestorben. Dieser Vorgang — im Detail kommen die Funktion und das Selbstverständnis der einzelnen Gewerkschaften zum Ausdruck! — gibt ein erstklassiges Lehrstück für den Zusammenhang von Basisdemokratie und Interventionsfilm ab.
Verhungere muess niemer (Behindertenfilmgruppe Zürich, 1980) interessiert über die Thematik hinaus vor allem durch das Organisationsmodell filmischer Arbeit. Den Rahmen zum Film bildet die Demonstration der Behinderten aus der ganzen Schweiz vor dem Bundeshaus während der Session am 6. Juni 1979. Im Hinblick auf das „Jahr der Behinderten“ 1981 formiert sich die Gruppe aus sechs Behinderten und drei Filmern der Super-8-Filmgruppe Zürich, um gemeinsam den erwähnten Film in eineinhalbjähriger Arbeit herzustellen. Ein Interventionsfilm im weiteren Sinne insofern, als die Filmemacher mit den Betroffenen und Beteiligten einer sozialpolitischen Bewegung an der Nahtstelle von Selbstdarstellung und gesellschaftspolitischer Situation arbeiten und versuchen die Dynamik der Konflikte auf eine mögliche herzustellende Veränderung hin in das filmische Konzept einzubringen. Dass <Jie Ansprache des Publikums und der Versuch emotionale Betroffenheit und Reflexion auszulösen, nicht nur über den Interventionsfilm laufen kann, zeigt im Bezugsfeld der Behinderten-Problematik Marlies Graf mit Behinderte Liebe (1979) auf einmalig radikale Weise. Auch diese Arbeit geht von der Initiative einer Gruppe von Behinderten und nicht Behinderten aus, der sich die Filmemacherin zur Verfügung stellt. „Die Hilflosigkeit gegenüber Invaliden ist meine Invalidität. Da nützt es nichts, die Natur als ungerecht zu erklären — gesellschaftliche Befreiungsmodelle scheitern. Nichts zu machen — kein Fazit, keine Lehre, keine Moral. Aber irgendwo bleibt die kleine Ahnung zurück, dass der Traum von der Befreiung vielleicht halt eben doch nicht an der Natur scheitert, sondern an unseren Klischees.“ (Peter Bichsei, in: CINEMA 1/79)
Lieber Herr Doktor (Filmgruppe „Schwangerschaftsabbruch“, 1977) ist wohl das Paradebeispiel des Schweizer Interventionsfilms. Die Arbeit entsteht 1977 im Zusammenhang mit der Abstimmung über den straflosen Schwangerschaftsabbruch. Die Filmgruppe, die die Fristenlösung unterstützt, setzt sich aus Aerzten der Vereinigung unabhängiger Aerzte Zürich, Frauen der INFRA, Beratungsstelle für Frauen, und aus Filmemachern des Zürcher Filmkollektivs zusammen. Der Film soll keine Parolen verbreiten, sondern „Denkmuster in Bewegung bringen, Verständnis wecken für eine demokratische Denkart, die dem einzelnen, hier den Frauen, ein Recht auf Selbstbestimmung einräumt“ (Informationsblatt). Entsprechend offen — nicht standpunktlos oder „ausgewogen“! — geht der Film das Problem an. Das Kernstück bildet eine achtminütige Einstellung, die eine Abtreibung nach der Absaugmethode zeigt. Dieser Film wird den Einwohnern der Gemeinde Ennenda im Kanton Glarus vorgeführt. Equipengespräche, Porträts von Frauen, die abgetrieben haben und Bilder von Frauen am Arbeitsplatz, aus Kinderkrippen von Interviews mit ledigen Müttern leuchten die Fragestellung von der privaten Selbsterfahrung bis zur gesellschaftspolitischen Bedeutung aus. Wie beim zwei Jahre später entstandenen Film Kollegen etwa, werden hier das Medium des Films und die Funktion der Filmemacher wie auch des Interventionsfilms als Instrument der Information und Aufklärung im Film selbst thematisiert und reflektiert. Auch dieser Film wird in der Abstimmungskampagne über hundert Mal eingesetzt. Im Zeitpunkt, da dieser Aufsatz geschrieben wird, steht die Abstimmung über die Initiative von „Recht auf Leben“, die sich nicht nur gegen jegliche Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs, sondern auch gegen Verhütungsmittel richtet, vor der Tür (9. Juni 1985). Die Initianten der Volksinitiative „Recht auf Leben“, eine „buntgescheckte Koalition, die von Vertretern der Landeskirchen bis zu Sektierern, von CVP-Mit- gliedern bis zu Republikanern, von Humanisten bis zu Rassisten reicht“, (Tages Anzeiger Magazin, 4. Mai 85) betreiben u.a. mit dem amerikanischen filmischen Machwerk Der stumme Schrei (die Ausstrahlung am TV wurde verboten) massive Propaganda, während Lieber Herr Doktor, ein Film, der heute nichts an Aktualität eingebüsst hat, im Archiv des Verleihs liegt und niemand von den Befürwortern einer demokratischen, liberalen Lösung sich findet, um, wie anno dazumal, loszuziehen und Gegeninformationen zu vermitteln.
Die Autoren und Autorinnen der hier kurz erwähnten Filme arbeiten aus einem wie auch immer gearteten konkreten Bezug zur jeweiligen Thematik: aus biographischen, geschlechtsspezifischen, beruflichen, gesellschaftlichen Gründen. Sie verstehen sich als Teil einer gesellschaftspolitischen Bewegung, als von gesellschaftspolitisch sich Bewegenden Angesprochene und Spezialisten, die zu Hilfe gerufen werden. Sie arbeiten oft in Kollektiven, zum Teil mit den Aktivisten zusammen, für die Herstellung alternativer Finanzierungs- und Produktionsstrukturen. Sie stellen sich selbst und ihre Arbeit in den Dienst einer Sache und politisch aktiver Gruppen und „an deren Seite“. Sie suchen und bestimmen den Ort, von dem aus Filmarbeit in der Thematik, der Aesthetik (dies ist der heikelste Punkt!), der Produktion und Distribution die entsprechende — emanzipatorisch innovative — Funktionsbestimmung in einem gesellschaftspolitisch definierten lebensweltlichen Zusammenhang erhält. Dabei beanspruchen die Interventionsfilme nicht nur eine kritische Analyse gesellschaftlicher Realitäten und Prozesse zu leisten, sondern auch Wirkung zu erzielen: Gegenöffentlichkeit und -Information, Aufklärung, die Stiftung von Solidarität, Mobilisierung und die Stärkung von politischen Bewegungen. Der Interventionsfilm ist als solcher zu verstehen und vom kritischen Dokumentarfilm im Stil etwa von Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. (Richard Dindo/Niklaus Meienberg, 1975/76) oder JE KAMI oder Dem Glück ist ganz von dieser Welt (Roman Höllenstein, 1978) zu unterscheiden, indem er thematisch auf konkrete politische, soziale und kulturelle Ereignisse und Vorgänge eintritt, sich an einer momentanen oder latenten Aktualität orientiert, eine eindeutige Position bezieht, Agitation betreibt oder einen Diskurs aufnimmt, und indem sich seine Funktion als Instrument der Meinungsbildung formal und konzeptuell niederschlägt. Neben den genannten Filmen, die, wie erwähnt, in engerem Bezug zu gesellschaftspolitischen Bewegungen, Basisinititativen und Abstimmungskampagnen stehen, gibt es andere Beispiele: so etwa die — kürzeren oder längern — pamphletartigen Agitationsfilme oder Filme, die die problemorientierte Analyse eines Segments unserer Erfahrungsrealität mit der theoretischen Reflexion vermitteln. Für letztere liefert Zur Wohnungsfrage 1972 (Nina und Hans Stürm, 1972) ein ausgezeichnetes Beispiel. Den Autoren gelingt es, nicht „nur“ einzelne Aspekte der Wohnproblematik unserer Gegenwart darzustellen — wie etwa Die grünen Kinder (Kurt Gloor, 1971) —, sondern die „Grundzüge kapitalistischer Stadtplanung aufzuzeigen, zu dokumentieren, anschaulich zu machen“ und durch den Aufbau des Films und die Montage „einen klaren Argumentationszusammenhang herzustellen“ (Informationsblatt). Es ist einer der wenigen Schweizer Filme, in dem die Dialektik der theoretischen Analyse nahtlos in die Form des Films übergeht und Theorie und Wahrnehmung der Realität sich gegenseitig bedingend konkretisieren. Zudem verkommen hier die Bilder nicht zur äusserlichen Illustration des Kommentars. Wie bei vielen Interventionsfilmen ist die Arbeit in einzelne Kapitel mit Ueberschriften unterteilt. Damit ist u.a. auf eine Tradition verwiesen, auf die sich diese Filme beziehen, insbesondere auf die Theaterarbeit von Bertolt Brecht. Mitzudenken ist das kulturelle Umfeld, in dem Brecht arbeitet: die Avantgarde des russischen Revolutionsfilms, die theoretischen Schriften Walter Benjamins, die revolutionäre Montagetechnik verschiedener Künstler, die im antifaschistischen Kampf der zwanziger und dreissiger Jahre entwickelt werden. Es handelt sich dabei um eine ästhetische Praxis, die von der 68er Bewegung neu entdeckt wird. Der Aufbruch Ende der sechziger Jahre bedeutet gleichzeitig den Beginn des Schweizer Interventionsfilms der siebziger Jahre. Z«r Wohnungsfrage 1972 steht nicht im Umfeld einer bestimmten politischen Aktion. Der Film greift ein „Dauerthema“ auf, wie es zu demselben Thema Erich Liebi mit Wenn die City kommt, ist es zum Davonlaufen (1980) versucht oder die Filmemacher mit den erwähnten kritischen Arbeiten zur Frage der ausländischen Arbeiter in der Schweiz oder diejenigen, die sich auf unterschiedlichste Weise mit der Problematik des Strafvollzugs und der Gefängnisse auseinandersetzen, so etwa Markus Imhoof mit Rondo (1968), Violet Moser und Paolo Spozio mit Unsichtbare Mauern (1978) und Urs Graf und Kollektiv in Zusammenarbeit mit der Diskussionsgruppe der Strafanstalt Lenzburg mit Wege und Mauern (1982). Ein weiteres Beispiel liefert die Filmgruppe Demokratische Rechte mit Aufpassen macht Schule (1978): Die Filmgruppe erarbeitet mit Lehrern und anderen am Sachgebiet Interessierten ein Drehbuch im Rahmen der allgemeinen Zielsetzungen des Demokratischen Manifests. Im Zentrum steht die Fragestellung, welchen Einfluss Rezession und Berufsverbote auf die Person und Arbeit des Lehrers haben.
Die hier genannten Filme setzen auf den dokumentarischen Wert des authentischen Tons und entwickeln die Filmarbeit zum Teil in Zusammenarbeit mit den Betroffenen. Sie vermitteln Erfahrungen und Aussagen, die der Zuschauer im Kino aufnehmen kann, wenn er will, und die teilweise im Film in einen grösseren Zusammenhang gebracht sind und/oder in einer die Filmvorführung begleitenden Diskussion vertieft werden können. Nina und Hans Stürm dagegen erarbeiten die Wohnungsfrage im Film in der Form eines analytisch dialektischen Diskurses, den das Publikum mitvollziehen muss, will es dem Film folgen. Indem das Denken Theorie und Erfahrung vermittelt, die verschiedenen Elemente der Wirklichkeit auf ihre Funktion befragt und sich im Filme-Machen realisiert, erweist es sich als das gesellschaftliche Verhalten, das Brecht mit „eingreifendem Denken“ bezeichnet. Das macht diese Arbeit zum Interventionsfilm.
Als Titel agitatiorischer Pamphletfilme im weiteren Sinn nenne ich abschliessend auswahlsweise Ormenis 199 † 69 (Markus Imhoof, 1969), einen Film gegen die Beibehaltung der Kavallerie; Krawall (Jürg Hassler, 1970), ein Dokument von den Zürcher Globuskrawallen, das einerseits mit spontan und „life“ gedrehten action-Bildern arbeitet, anderseits aber auch Hintergrundinformationen einbringt und die Zürcher Unruhen in einen gesamteuropäischen Rahmen zu stellen versucht; Pour un foyer collectif (Jürg Hassler, 1971), ein kleiner, schnell gemachter „Szenefilm“ über die Bunkerjugend und deren Kampf um ein autonomes Zentrum; Sebastian C. Schroeder dreht 1973 Der Bucheggplatz zum Beispiel, eine elf minütige, streckenweise enorm dynamisch montierte Collage aus Statements und Aufnahmen vom Zürcher Bucheggplatz, einem der Zürcher Verkehrsknotenpunkte, zum Thema Verkehrsplanung, Privatwirtschaft und Missachtung des Menschen. Karl Saurer, Hannes Meier und Erwin Keusch gelingt mit Es drängen sich keine Massnahmen auf (1973) eine witzige Satire zum Thema Zensur und Selbstzensur am Fernsehen, in der sie das Verbot ihrer eigenen Beiträge zur Jugendsendung Die Kehrseite des Deutschschweizer Fernsehens reflektieren. In Sieg der Ordnung (1976) dokumentiert Erich Langjahr den Mieterkampf, die Häuserbesetzung am Zürcher Hegibachplatz, die polizeiliche Räumung und den Abbruch der Häuser. Mit Preis der Angst dreht die Super-8-Gruppe Zürich 1978 einen Film als Beitrag zum Abstimmungskampf gegen die Bundessicherheitspolizei, der in bezug auf die Form und Bildsprache in diesen Zusammenhang gehört, in bezug auf die Funktion neben u.a. Lieber Herr Doktor, Gösgen oder Kaiseraugst zu stellen ist.
Heute entstehen in der Schweiz kaum mehr Interventionsfilme. Die Filmemacher haben sich wieder dem klassischen Dokumentarfilm zugewandt und hier neue Formen zu entwickeln versucht, so etwa Erich Langjahr mit Morgarten findet statt (1979) und den zwei Kurzfilmen Made in Switzerland (1980) und Do it yourself (1981); Alexander J. Seiler: Ludwig Hohl (1982); Hans Stürm mit Villi Hermann und Niklaus Meienberg: Es ist kalt in Brandenburg (Hitler töten) (1980) und mit Beatrice Leuthold Gossliwil 1985); Mathias Knauer: El pueblo nunca muere (1985). Andere haben den Schritt zum Spielfilm gemacht: Sebastian C. Schroeder: O wie Oblomov (1982) und Haus im Süden (1984) oder Markus Imhoof mit Fluchtgefahr (1974), Das Boot ist voll (1981) u.a.
Die jüngere Filmer-Generation vertritt zum grossen Teil die Meinung, dass der in den siebziger Jahren in der Folge der 68er Revolte entwickelte Interventionsfilm weder eine Chance hat, auf das politische Geschehen einen Einfluss zu nehmen (er sei zu „kopflastig“, zu theoretisch und zu sehr einer Politik verpflichtet, die generell abgelehnt wird), noch dass er das geeignete Instrument darstellt, das eigene, „neue“ Lebensgefühl auszudrücken. In ihren Filmen — Züri brännt (1980), Zwischen Betonfahrten (1981), Eine vo dene (1980), Heute und danach (1981), Windplätze: aufgerissen (1982) u.a. — setzt sich denn auch eine subjektiv phantastische, oft surreal anarchische, spontan chaotische Filmsprache durch, die sich deutlich von den diskursiv analytischen, beweisführenden und aufklärerischen Interventionsfilmen der 68er-Väter und -Mütter abhebt. Am ehsten findet die Arbeit der „Politischen“ ihre Fortsetzung in gewissen Tendenzen der aktuellen Video-Produktion, auf die ich hier jedoch nicht eingehen will (vgl. den Beitrag in diesem Buch von Gerd Roscher).
Ist damit ein wichtiges Kapitel des engagierten Schweizer Filmschaffens abgeschlossen? Hat sich der Interventionsfilm als Traum der 68er Generation oder gar als Irrtum erwiesen? Waren es „falsche“ Filme? In Gesprächen mit den Filmemachern zeigt sich, dass durchgehend die Notwendigkeit dieser Arbeiten erkannt wird, dass gleichzeitig aber verschiedene Faktoren erwähnt werden, die diese Art des Filmemachens heute als fragwürdig erscheinen lassen. Dazu einige Stichworte.
Der Schweizer Interventionsfilm orientiert sich an der politischen Kultur der Schweiz, konkret: an der (Wieder-)Belebung der direkten Demokratie. Es ist bekannt und in der entsprechenden Literatur vielfältig analysiert worden, dass das politische System der Schweiz mit der Kollegialregierung als Konkordanzdemokratie im Zeichen der „Proporzgerechtigkeit“ (Richard Bäumlin) im Entscheidungsfindungsprozess und den Konfliktregulierungen einseitig Strategien des Kompromisses und des gütlichen Einvernehmens gegenüber einem offenen Austragen der Konflikte und der Ausbildung einer effektiven Opposition bevorteilt. Wobei das „Ueberwiegen der Konkordanzstrategien“ (Jürg Steiner) nicht bedeutet, dass alle gleichermassen zum Zug kommen. Sogar Volksrechte wie das Referendum eignen sich heute „vor allem als Instrument der Interessenpolitik finanzstarker Verbände“ (Richard Bäumlin), und die politische Innovation durch die direktdemokratische Institution der Volksinitiative hat sich (zu) oft in ihr Gegenteil gekehrt. Dementsprechend haben sich in der Schweiz kaum eine Tradition und Praxis der öffentlichen politischen Auseinandersetzung ausgebildet. In diesem Klima hat der politische Interventionsfilm auf Sand gebaut, mit seiner Funktion ist er oft ins Leere gelaufen, und mit ihrem Anspruch sind die Filmemacher denn auch zum Teil überfordert. Man erhoffte sich „Wirkung“ und „Aufklärung“ und erntete — ausser in den eigenen bewegten Kreisen — Schweigen und Gleichgültigkeit. Vereinzelte Zensurmaßnahmen konnten dabei sogar als Erfolg verbucht werden.
Auf die Frage „Welchen Film wollen wir? Und für wen wollen wir ihn?“, die die Zeitschrift cinebulletin im Jahre 1985 an verschiedene Filmleute stellte, antwortet Freddy Buache u.a. folgendes: „Der sozialkritische Film, voller beunruhigender Fragen, der rigoros den Schleier von all den Entfremdungen reisst, welche Leute hinter dem Schein gar nicht mehr wahrzunehmen vermögen, dieser Film ist heute nötiger und dringender denn je und darf mit keinerlei frommen Lügen liebäugeln. Dennoch muss man auch begreifen, dass jeder rein politische Widerstand sehr rasch zum Alibi für die herrschenden Kräfte wird, d.h. eine oberflächliche Scheinkultur, die leicht vom System einvernommen werden kann, während die Subversion sich unter solchen Bedingungen auf die Stärke der Phantasie, der Poesie besinnen muss, auf eine Gefühlswärme, die sich halsstarrig den Zähmungsversuchen, diesen bewährten Waffen der offiziellen Moral und des Geldes entzieht.“
Zur alles nivellierenden Integrationsfähigkeit des „Systems“ kommen die Auswirkungen des seit einigen Jahren sich einseitig ausbildenden kulturellen und politischen Klimas, einer fin-de-siècle-Stimmung. Vielfältig wird die Zivilisationskrise beschworen, Endstimmung ist „in“, Zynismus Rezept zum Ueberleben. Das Ende der Moderne sei gekommen, ein „Danach“ nicht zu finden, ausser im Roll-Back der zitierten Vergangenheit. Erfahrungs- und Orientierungsverlust des Handlungs-Sinns sind die von den Kulturpessimisten und der neokonservativen Kritik an die Wand gemalten Zeichen der Zeit. Die Wirklichkeit schwindet, die Realität manifestiert sich als Simulation, die Geschichte ist irreal geworden, die Politik aus dem Leben verschwunden. Symptomatisch für diesen ideologischen Zusammenhang sind die Aeusserungen Alain Tanners (Tages Anzeiger Magazin, 20.4.85) und nicht zuletzt auch sein Film No Man’s Land. In einer Gegenwart, in der es „keine Kommunikation mehr zwischen dem einzelnen und den gesellschaftlichen Strukturen“ gibt, sucht Tanner das Gegenwärtige nicht im Diskurs, in der Politik, den Botschaften, den Entwürfen, sondern indem er versucht, „von den Leuten zu sprechen, die etwas zu tun haben mit jenen, die da im Saal sitzen. (...) von Energie und Liebe.“ Rückblickend meint Tanner: „In den siebziger Jahren bewegte ich mich mit meinen Filmen in einem gesellschaftlichen Zusammenhalt, in dem ich funktionieren konnte. Eigentlich bin ich sehr gut in die Geschichte gefallen. Die Jüngeren, jene, die heute beginnen, fallen wahrscheinlich viel schlechter. Mein Bewusstsein formte sich in der Zeit des kalten Kriegs und mit dem Kommunismus (...), mit dem Surrealismus und Existentialismus. All das kam schön zusammen und ermöglichte und nährte einen zusammenhängenden Diskurs. Und mit diesem Diskurs war ich niemals allein. Heute ist das Gegenteil der Fall.“
Die Interventionsfilmer waren, wie erwähnt, Teil von politischen Gruppen und Bewegungen — oder stellten sich diesen zur Seite —, die zu einem grossen Teil nur kurzfristig und aktionsgebunden sich konsituierten oder aus verschiedenen Gründen auseinanderbrachen und versandeten. So fühlten sich die Filmer zwischen Stuhl und Bank, sie vermissten die Kontinuität ihrer Arbeit und damit verbunden die Entwicklung eines eigenen Filmschaffens, eines persönlichen Oeuvres. Einige glaubten, die persönliche Handschrift — Kriterium eines „eigenen Werks“ — nur durch die zunehmende Individualisierung und „Unabhängigkeit“ ihres Schaffens zu erlangen. In diesem Zusammenhang ist auch der Trend zum Spielfilm zu sehen. Dass dabei die Tendenz zur Gigantomanie und die Angleichung an internationale, d.h. meist amerikanische Massstäbe einhergehen, sei nur am Rande vermerkt.
Nach 68 glaubte man zu wissen, wohin stehen und gehen. Die theoretische Debatte gab den Rahmen und das Instrumentarium zur Analyse ab und stellte ein Wissen zur Verfügung, das es an den Mann und die Frau zu vermitteln galt. Die Filmarbeit, die als Arbeit in ihrem Verhältnis zur produktiven gesellschaftlichen Arbeit reflektiert wurde, hatte damit eine definierte Funktion und bestimmte (kollektive) Produktionsformen, aus denen die Distributionsstrukturen abgeleitet wurden. Der revolutionäre Sprung führte in einer Hinsicht nicht über die Tradition der bürgerlichen Aufklärung hinaus: Man war überzeugt, dass der aufklärerische Impetus „greift“, dass es möglich sei, mit Wissensvermittlung und Ueberzeugungskraft hinter der eigenen Ansicht Massen zu versammeln. Wurde der Interventionsfilmer somit zum Rattenfänger von Hameln? Diese realpolitische und ideologische Geborgenheit ist spätestens in den frühen achtziger Jahren zerbrochen. Die Antworten auf die erwähnte Umfrage im cinebulletin liefern dazu — neben den Filmen, die seit einigen Jahren die Produktion dominieren — Material. Keiner der angesprochenen Filmemacher weiss mehr, was der Plural „wir“ in der Fragestellung bedeuten soll. Die meisten sagen sinngemäss: „Ich mache den Film, den ich will, und ich mache ihn fürs Publikum.“ „Unser“ Film entsteht nur, wenn jeder seinen „eigenen“ Film macht, meint Alexander J. Seiler. So weit, so gut. Das trifft auch für die Interventionsfilme zu: Der „gute“ Interventionsfilm ist nicht derjenige, der nur für andere gemacht wird. Der Begriff „Intervention“ — und die kollektive Produktionsweise — bezeichnet nicht den Film ohne Subjektivität. Er bezeichnet vielmehr die Funktionsbestimmung des Filmemachens, aus der sich Produktions- und ästhetische Form ableiten lassen, d.h. die Reflexion des eigenen Tuns in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang: „Gute“ Interventionsfilme sind somit gesellschaftlich notwendige Filme. Denkt man darüber nach, wird klar, dass „Eigenheit“ nicht den Markt bedienende Originalität meint, dass Subjektivität nicht „mehr Bauch“ und „weniger Kopf“ heisst und Sozialkritik nicht Phantasie, Poesie und Gefühlswärme ausschliesst. In diesem Sinn kann und muss sich der Interventionsfilm weiterentwickeln. Es genügt nicht, „dabei zu sein“ und auf ein Ereignis die Kamera „draufzuhalten“, Theorien und Kommentare zu illustrieren, Meinungen und Ansichten in Interviewform zu verbreiten und auf die Ueberzeugungs- und Beweiskraft der Analyse sogenannter Sachverhalte zu bauen — alles „Jugendsünden“ dieses Filmgenres. Die filmische Intervention kann lernen von der ästhetischen Innovation des Dokumentarfilmschaffens, von Es ist kalt in Brandenburg (Hitler töten), Gossliwil, Max Frisch, Journal Z-ZZZ (Richard Dindo, 1981) etwa.
Hans Stürm, der in unserem Zusammenhang wohl bedeutendste Kameramann und Filmemacher der Schweiz, meinte in einem Gespräch zu diesem Artikel: „Früher vertrauten wir noch mehr auf ein gesichertes Wissen, wir glaubten an die direkte Wirkung der Filminformation, an die Aufklärung über Sachfragen. Früher dachte ich, ich weiss mehr, als die anderen. Zudem hat das Publikum heute nicht mehr die Bereitschaft, darauf einzugehen — die Ueberflutung mit Informationen hebt die Wirkung der Gegeninformation auf. Heute bin ich nicht mehr bereit, schnell zu reagieren und etwas ‚hinzuwerfen’, ich will,meinen’ Film und diesen sorgfältig aufbauen, will keine Antworten liefern, sondern Fragen stellen. Ich verstehe meine Filme als öffentliches Nachdenken. Heute geht es den Filmern vermehrt um ihre Selbstverwirklichung.“ Und Alexander J. Seiler, der zur Zeit eine Pause einschaltet, um nachzudenken und zu schreiben, antwortete im cinebulletin mit entlarvender Offenheit: „Für wen wollen wir den Film? Natürlich immer erst einmal für uns selber, unser Aus- und Fortkommen, unsere Eitelkeit, unseren Geltungsdrang, unsere — wie sagt man? — Selbstverwirklichung. Das ist legitim, man darf es nur nicht verschleiern. Aber zugleich machen wir die Filme, ob wir es wollen oder nicht, auch für unsere Geldgeber, und das heisst: für Expertengremien, Kulturbeamte, Fernsehgewaltige. Das Publikum kommt — auch als Geldgeber — an letzter Stelle, und das spürt es.“
Hinter den meisten Interventionsfilmen stand der „jugendliche Elan“ der Filmemacher, die mit diesen Arbeiten zum Teil ihre Karriere als Filmer begannen, mit denen aber keine Karriere zu machen war. Längerfristig wollten die Filmer nicht „nur einer Sache dienen“ und „eingreifen“ und sich auf die Oeffentlichkeit, die der Parallelverleih herstellt, beschränken. Das Ziel war vielmehr der Kinofilm. Diese Haltung wirkte sich dann auch auf die kollektiven Produktions- und Arbeitsformen aus — symptomatisch war das Auseinanderbrechen des Zürcher Filmkollektivs in seiner ersten personellen Zusammensetzung Ende der siebziger Jahre. Dazu kommt, dass der Parallelverleih nach fruchtbaren Ansätzen ebenfalls in den siebziger Jahren zunehmend an Effizienz und Möglichkeiten verlor und heute praktisch nicht mehr existiert. Auch diese negative Entwicklung hat ihr Umfeld: Von Solidarität unter den Filmemachern — der technische Stab mit einbezogen — ist heute kaum mehr etwas zu spüren, auch bei den Linken nicht! Anstatt Schulter an Schulter zu stehen, sich zu helfen, gegenseitig sich anzuregen und eine kritische Diskussion zu führen, bosselt jeder mit der Rechtfertigung des Künstlers als Individualisten vor sich hin, drängt mit der einen Seite an die Quellen der öffentlichen und privaten Gelder und buhlt mit der andern um die Gunst des Publikums. Dem Kollegen gegenüber sitzt der Rückenschuss lockerer als das ermutigende Wort. Zu dieser misslichen Situation haben u.a. das Abklingen des hoffnungsgeladenen Elans der späten sechziger Jahre und die mangelnde Fähigkeit der Verarbeitung von Fehlern, der Umsetzung von Ideen und Theorien und der Einübung von Widerstand in einer Demokratie und einer politischen Situation, die sich durch repressive Toleranz auszeichnen, geführt: Das trifft nicht nur auf die Filmer, sondern auf uns alle zu. Dass wir uns allein fühlen hängt damit zusammen, dass wir es effektiv auch sind und nicht damit umgehen können und ist gleichzeitig die Kehrseite der Tatsache, dass wir, wenn wir — partiell — mitmachen und ein Auge des utopischen Blicks zukneifen auch zu dem kommen, was wir irgendwie auch erreichen wollen. Denn wer will schon über Jahre hinweg Einsamkeit, Selbstausbeutung, finanzielle Not, mangelnde Anerkennung — scheinbar den notwendigen Preis für engagiertes Denken und Verhalten?
Im Zusammenhang mit diesem ungelösten Konflikt — und nur in diesem Zusammenhang — wirkt sich die Entwicklung auf dem Medienmarkt verschärfend auf die Situation der Filmemacher aus. Der Kassettenboom und die Expansion des Kabel- und Satelliten-Fernsehens fördern die Konkurrenz. Um das Publikum vom TV-Schirm weg ins Kino zu locken oder am TV-Schirm bei der Stange zu halten, muss man, so die Ansicht vieler Filmautoren, „attraktivere“ Filme machen, d.h. u.a. nicht Filme, die auf direkte Art das aufgreifen, was einen alltäglich beschäftigt und belastet und die uns ohne Glücksversprechen in unserer Einsamkeit ansprechen.
Die Entwicklung des Interventionsfilms beinhaltet wesentlich die Gratwanderung der versuchten Vermittlung zwischen der Vereinzelung des Einzelnen und dem Kollektiv, die Frage nach dem kollektiven Subjekt. Sie ist insofern zeitgemäss, als sie die Krisen- und Umbruchsphasen der (nach)industriellen bürgerlichen Gesellschaft widerspiegelt. Die weiterführenden Ansätze und retardierenden Fehler dieser Filmpraxis sind in diesem Bezugsfeld zu analysieren. So ist es kein Zufall, dass im Schweizer Filmschaffen der Interventionsfilm praktisch ausschliesslich im Deutschschweizer Film und von Männern realisiert wurde, eignet doch den einzelnen verwirklichten Projekten etwas Lehrhaftes an — während der Westschweizer Film mehr auf die Sprengkraft der Phantasie setzt(e) — und zudem in der Wirkungsabsicht etwas von einem Herrschafts- und Machtanspruch, das den Filmarbeiten von Frauen fremd ist. Daraus ist zu lernen: Der Interventionsfilm hat sich nicht überlebt, im Gegenteil. Ihm wesentlich ist, dass er über die Diskussion über „Inhalt“ und „Form“ filmischer Arbeit hinaus deren Funktionsbestimmung thematisiert, in bezug auf den einzelnen Filme-Machenden wie die Gemeinschaft der Einzelnen, in bezug auf das Verhältnis von kultureller Arbeit und produktiver Arbeit, in bezug auf die Frage, wie filmische Arbeit nicht z« den Produktionsverhältnissen, sondern in ihnen steht (Walter Benjamin).
Im Spannungsfeld von „Demokratisierungs- und Denunziationstaktik“ und „Belebung einer demokratischen Konfliktkultur“ (Martin Schaub, CINFMA 1983, S. 104) manifestieren sich die Problematik der didaktischen Traktatfilme und der pamphletartigen Agitationsfilme und gleichzeitig ihre Notwendigkeit. Die Problematik, die sich nicht zuletzt offenbart an der einseitigen Konzentration auf das, was vor der Kamera — und in den Köpfen der Filmer — sich ereignet und der entsprechenden Vernachlässigung dessen, was mit der Kamera geleistet wurde. Die Notwendigkeit, die der Interventionsfilm erweist, indem er den Bezug zur politischen Realität, die wir mitgestalten, -ertragen und -verantworten, nicht auf die Frage des Inhalts, sondern als den zentralen Aspekt filmischer Arbeit zur Diskussion stellt.