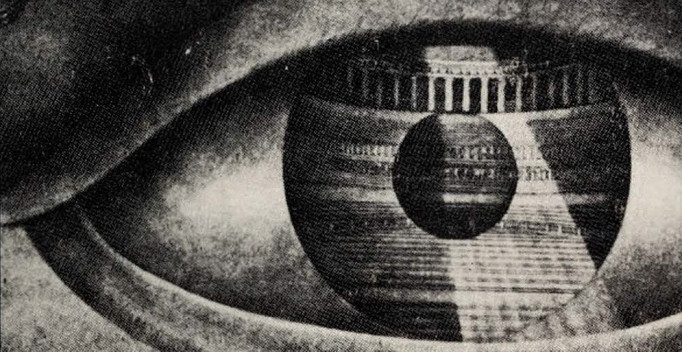Der Vorsatz, aus der Diskretion und Kleinmütigkeit des durchschnittlichen Schweizer Kinofilms auszubrechen, meldet sich in den ersten Tönen und Bildern (in dieser Reihenfolge) von Francis Reussers neuem Film schon klar an. Es erstaunt eigentlich nicht, dass es Reusser ist, dem die Bescheidung des Schweizer Films nichts mehr sagt. In seinen Filmen (Le grand soir und Seuls) sowie in jenen Daniel Schmids hat sich eine Art „Rückeroberung“ der heroischen schweizerischen Szenerien bereits früher angekündigt, und die Musik als Luftkissen von Filmbildern hat man bei beiden schon erleben können
Reusser bedient sich für die Wende aus dem grüblerischen, intimistischen Kino der siebziger Jahre eines Stücks konsekrierter schweizerischer Literatur — so wie sich Schmid bei „Violanta“ einer Novelle Conrad Ferdinand Meyers bediente. Aus dem 1934 erschienenen populärsten Roman von Charles Ferdinand Ramuz löst Reusser jene Thematik heraus, die ihn auch in seinen früheren Spielfilmen seit Vive la mort schon beschäftigt hat, jene von Vaterschaft und Liebe. Während Ramuz in seinem Roman eher eine (oder zwei) Wiedergeburt(en) beschwört — die Augenblicke, bevor der vom Bergsturz von Der- borence verschüttete Hirte Antoine das Tageslicht wieder erblickt und da er die Welt wieder neu in Besitz nimmt, sind das Zentrum des symbolischen Romans —, konzentriert sich Reusser auf Vaterschaft und patrimoine (was mit „Tradition“ und „Erbe“ nur unzulänglich übersetzt ist).
Er bleibt Ramuz insofern treu, als er keinen naturalistischen Film gemacht hat und, darüber hinaus, in seiner Sehnsucht nach Grösse, die das herkömmliche Heimatverständnis sprengt.
Der vater- und vaterlandslose Reusser will sich eine Zugehörigkeit mit Macht erzwingen und hält für seinen neuen Schritt auch gewisse politische Erklärungen bereit; so behauptet er etwa, dass die Schweiz eigentlich nie eine moderne Zivilisation besessen habe, und dass sie ihre Identität in der alpenländischen Agrar- und Hirtenkultur zu suchen habe.
Solche Theorien und ihre relative „Gefährlichkeit“ kann man vergessen, wenn der Film in sich stimmt. Doch das tut Derborence nicht. Es gelingt dem Filmemacher nicht, den einmal angeschlagenen Ton durchzuhalten; der Film stürzt immer wieder ab, und zwar nicht in die grüblerische Reflexion, in die kritische Verwirrung, sondern ins ganz praktische Unvermögen. Reusser zeigt Schwächen in der Schauspielerführung (in der Schauspielerarbeit) und vor allem in der Dialogregie, ganz zu schweigen von den erstaunlichen dramaturgischen Schwierigkeiten mit einer doch sehr einfachen Geschichte. Die Brüche und Schwachstellen wirken um so verheerender, als man spürt, dass Reusser mit allen Mitteln eine Ueberwältigung des Zuschauers versucht hat; die besten Sequenzen sind mit- und hinreissend, nehmen gefangen; desto peinlicher oder unfreiwillig komisch wirken die Einbrüche, die keine pathetische Musik, und schon gar nicht der dilettantische, nur hohl dröhnende Dolby-Stereo-Sound des Films auszuebnen oder zu vertuschen vermögen.
So bleiben denn einzelne Sequenzen, die einen noch nicht gemachten „neuen Heimatfilm“ skizzieren mögen: die Eingangssequenz, in der sich die Kamera wie ein „Geist“ vom Himmel an den Ort der Handlung, in eine „Welt“ senkt, der Jubel einer Hochzeit, durchsetzt mit ebenfalls jubelnden Naturbildern zum Beispiel, aber auch die Entfesselung der Natur im Bergsturz und sogar den Aufbruch des ganzen Dorfes hinauf in die Felsmassen, in die sich Antoine — noch immer auf der Suche nach seinem Vater, wo er selbst bereits werdender Vater ist — zurückgeschlagen hat, würde ich dazu zählen. Da streift der Film jene mythische Dimension, die er ganz hat erobern wollen. Hätte er es geschafft, könnte und müsste man über den philosophischen und politischen Gehalt des Unternehmens diskutieren. So, wie er jetzt ist, lohnt es eigentlich nicht, bleibt nur ein Staunen über die Zitierung der „alten Werte, die wieder im Kommen sind“. Kämen sie daher wie etwa bei Tarkowskij, wäre Derborence eine echte Herausforderung. So, wie er trotz eines aussergewöhnlichen Aufgebots filmischer (und finanzieller) Mittel jetzt daher kommt, bleibt einem bloss die Feststellung, dass der Grübler Reusser bessere Filme macht als der natur- und liebestrunkene.
Seinem grossen Film hat Francis Reusser im Frühsommer einen mit bescheidensten Mitteln hergestellten Kurzfilm, La dernière page de Derborence, hinterhergeschickt, der seine eigene Zerrissenheit genuin filmisch skizziert: den ganzen Schmerz eines unsteten, gebeutelten, umhergerissenen modernen Menschen, der in seinen Beziehungsproblemen von Sinnen zu kommen droht. Reusser nimmt in diesem genialisch hingeworfenen Schrei die Figur des Jean (von Seuls) wieder auf. Vielleicht deutet er damit an, dass Derborence, obwohl alles andere als das geplant war, eine Episode bleiben wird.