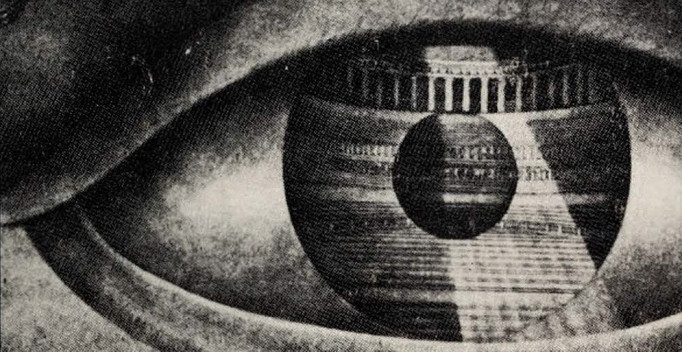Die lange Pause nach L’amour des femmes, das Geheimnis, mit dem Soutter das neue Projekt umgab, die Andeutungen, mit denen er dennoch davon sprach, die Schwierigkeiten mit der definitiven Titelfindung, das alles deutete auf ein aus der subjektiven Sicht des Autors zentrales Werk, auf die zentrale Thematik des Aussenseiters hin, der — in den gegenwärtigen Zeitläufen — Wirkung verliert. Soutter hat keine Flucht nach vorn gewagt, sondern eine Figur entworfen, die ihm noch mehr gleichen sollte wie all die anderen in den früheren Filmen: Renart, den Künstler, der ein Leben aufgeben will, das ihn bloss frustriert. Diese Rolle hat Soutter Tom Novembre auf den Leib geschrieben.
Renart, ein Kleinkünstler, „den die Leute lieben“, schmeisst seinen Job im Nachtklub. Er liebt die Garderobiere Hermeline; sie erwartet ein Kind von ihm. Die Arbeitgeber wollen Renart nicht ziehen lassen. Er aber scheisst ihnen buchstäblich ins Haus und zieht weg, ins noch provinziellere Abseits, wo er sich zu finden und seine Liebe zu leben versucht. Sie setzen ihm obskure Helfer auf die Fersen und sabotieren, was er neu auf die Beine zu stellen versucht. Die Vergangenheit — vor allem die Frauen seiner Vergangenheit — holt Renart ein. Er verscherzt das neue Glück; Hermeline verlässt ihn. Und er kann sich anstrengen, so viel er will: er hat das Glück verloren; nicht einmal das Kind wird er sehen können.
Soutters Geschichte irritiert mit ihrer Weltfremdheit. Der allegorische Charakter seiner Fabel (eine Fabel ist es; das deuten bereits die Namen an) wirkt angestrengt; die Grazie, einst der Charme von Soutters Filmen, ist weitgehend untergegangen in einem schon verzweifelt zu nennenden Wunsch nach Sinnproduktion.
Signe Renart ist in gewisser Hinsicht extremer als die früheren Soutter-Filme, vor allem auch in verbaler. Die Dialoge sind oft von einer fast verletzenden Direktheit, ein weiteres Zeichen für eine gewisse Verbitterung, für die Unlust, weiterhin als „Spieler“ missverstanden zu werden. Fragt sich nur, was Direktheit im Dialog einer solchen Kunstwelt bringt. Fragt sich auch, ob solche direkte Rede die eher schummrige, eher vieldeutige Inszenierung nicht desavouiert.
Gewisse Sequenzen haben die Leichtigkeit und den diskreten Glanz, die Soutters Werk auszeichnen. Jean-Bernard Menoud zaubert ein paar sehr geheimnisvolle Juralandschaften auf die Leinwand, und auch das Volksfest in der stillgelegten Fabrikhalle bekommt, nach unbeholfenem, steifem Beginn (Statisten!) durchaus Stimmung in einem märchenhaften Licht. Das demonstrative Spiel der wenigen Guten und der vielen Bösewichte, jener, die weich und beweglich sind und deshalb verlieren, und jener, die starr und rechthaberisch, „gerecht“ und brutal sind, hat weniger Dimensionen als ein paar gelungene Tableaux.
Trotz vieler eigenwilliger Einfälle Soutters ist mir die Zweifelhaftigkeit der Künstler/Welt- Fabeln noch selten so aufgefallen wie hier.