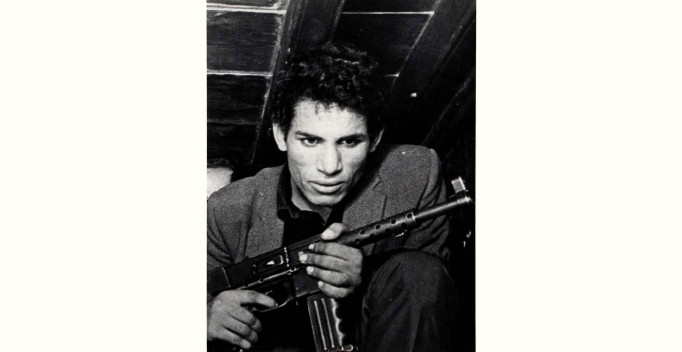Wenn sie über die Beziehung zwischen ihrem Kino und ihrer Geschichte sprechen, schlagen die Franzosen einen eigenartigen Ton an. Es ist allen klar, dass eine Bestandsaufnahme ernüchternd ausfallen muss (mit all den Klagen, wenig schmeichelhaften Vergleichen, unausgesprochenen Schamgefühlen), was aber nicht verhindert, dass diese amnesie française mit einem eher seltsamen Stolz einhergeht. Anders ausgedrückt: Frankreich — qui ne fait rien comme les autres pays- erwartet von seinen Filmschaffenden nicht mehr, dass sie von zeitgeschichtlichen Ereignissen Bericht erstatten oder gegen das Vergessen ankämpfen. Noch schlimmer: Bevor es jetzt bereits den Grossteil des weltweiten Kino erfasst hatte, begann dieses Den-Kopf-in-den-Sand-Stecken vor der Geschichte vielleicht sogar in Frankreich. Man muss zum Front populaire zurückgehen, um in Filmen von Renoir und Duvivier die gesellschaftlichen und politischen Ereignisse ihrer Zeit widerspiegeln zu sehen. Seither ist es mit dem Kino, Spass beiseite, une autre histoire, eine andere Geschichte. Die Auseinandersetzung war noch in vollem Gang, als die Nouvelle Vague ihren vielbeachteten Auftritt hatte. Warum, empörte man sich schon damals, sah man nichts über die Unabhängigkeitskriege der Kolonien, über Indochina, Algerien, nichts über Klassenkämpfe: Es ist eine Schande. Und noch kürzlich haben sich einige Leute naiv darüber gewundert, dass die Ereignisse des Mai 1968 nicht für einen grossen Film Stoff geliefert haben, weder während noch nach dem Geschehen, obwohl doch damals einiges los war.
Man kommt rasch mit der Antwort, dass zu informieren - wie auch immer zu informieren - und Ereignisse in die Umlaufbahn zu bringen, von nun an einzig und allein die Sache des Fernsehens sei. Das Ärgerliche dabei ist nur, dass in dem Moment, als das Fernsehen seine ersten Schritte tat, das französische Kino bereits entmutigt „die Feder aus der Hand gelegt hatte“.
Die fünfziger Jahre waren, was die Kritik anbelangt, gezeichnet vom Kampf, den sich die Redaktionen von Positif und Cahiers du Cinema lieferten. Erstere, Vertreter der Linken und des Surrealismus, verlangten zu recht, dass dem Kino die noble Aufgabe zukomme, jeglicher Zensur zu trotzen und als Zeuge der Geschichte aufzutreten, die sich gerade abspielte. Letztere, unpolitisch oder offenheraus rechts stehend, hatten mehr Mühe, ihre Sachen zu vertreten, denn es ging ihnen um ein narzistisches Kino, streng auf die Form bedacht, kleinbürgerlich oder klein und unbedeutend schlechthin. Peinlich berührt auch hier, dass alle bedeutenden Filmschaffenden in der zweiten Gruppe zu finden waren und kein einziger in der ersten. Die Tugendhaftigkeit der Linken hatte kein Talent, und schon damals machten die Moralisten bessere Filme als die Engagierten. Sicherlich, es gab einige Filme, die den Mut hatten die Dinge beim Namen zu nennen: einen Kolonialisten einen Kolonialisten, und Kämpfe um mehr Gerechtigkeit gerechte Kämpfe. Aber diese Filme gehörten zur Vergangenheit des Kinos. Ältlich, ungeschickt und kraftlos: In der Regel vergass man sie schnell.
In der Tat, der dem französischen Film der Jahre 1955 bis 1968 gemachte Vorwurf bezog sich auf die beiden Unabhängigkeitskriege, verspätete Schwierigkeiten eines von der Zeit eingeholten Reiches. Nicht ohne Grund waren die vorangegangenen Kriege von diesen Vorwürfen ausgenommen. Der erste Weltkrieg war ein imperialistisches Schlachten gewesen, welches in Frankreich (Gance) wie in den Vereinigten Staaten (Griffith, Vidor) traumatisierte und eher pazifistische Filme hervorgebracht hatte.
Der zweite Weltkrieg war verloren, eh’ man sich’s versah, und die Geschichte Frankreichs wurde für einige Jahre zur Geschichte eines in diesem Jahrhundert allein dastehenden rückgratlosen Kollaborierens: Zusammenarbeit mit der Besatzungsmacht, beflissen antijüdische Politik, behütetes Kino grosser Kalligraphen in von der Welt abgeschnittenen Studios. Und dann nach dem Krieg, das unrühmliche Vergessen von Unangenehmem und das Übertreiben der Rolle der Resistance in der Befreiung des Landes.
Frankreich - wie auch Österreich - brauchte nicht durch eine Zeit kollektiven Trauerns zu gehen und von seinen Künstlern zu verlangen, dass sie den Mut aufbrächten, Ereignisse, welche in mehr oder weniger grosser Teilnahmslosigkeit erlebt worden waren, in Bilder und Figuren umzusetzen. Es dachte, sich dies ersparen zu können, und konnte lange Zeit auch annehmen, dieses Ziel so gut wie möglich erreicht zu haben. Das Österreich Waldheims und das Frankreich Le Pens haben sich geirrt.
Das Bild von Frankreich als Kriegsgewinner war verführerisch und wiegte in Sicherheit. Die Resistance lebte fort in Form zweier wahrhaftiger Mythen: De Gaulle zur Rechten, der PCF zur Linken. Am Ende des Krieges geboren zu werden bedeutete, im Schatten dieser doppelten Legitimation gross zu werden, im Schatten eines Gesichts, mit dem man sich sehen lassen konnte. Frankreich war nunmehr „repräsentiert“, aber es hatte begonnen, seiner wirklichen Geschichte fernzubleiben.
Paradoxerweise ist diese „Absenz“ der Grund dafür, dass das französische Kino seit Kriegsende ästhetisch bedeutend zu werden begann. Anstatt „vor ihrer eigenen Türe zu kehren“, richteten die französischen Kritiker und Filmschaffenden ihren Blick auf ihre Nachbarn und auf ein Land, wo sie endlich leidenschaftliche und spannende Verhältnisse vorfanden. Dieses Land war Italien, und man weiss sehr gut, in welchem Grad die Erfindung des italienischen Neorealismus ebenso das Werk der Franzosen war wie der Italiener.
Derjenige, welcher von Roma, citta aperta am Tag seiner Aufführung in Paris dermassen erschüttert wurde, dass er vor Erregung beinahe zu stammeln begann, war André Bazin. Wer einige Jahre später mit einem Schlag begriff, welche Art Kino ihm zu machen bestimmt sei, war Eric Rohmer - unter dem Eindruck des visionären Stromboli. Und Rivette schrieb zehn Jahre später von seinem Sanatorium aus zu Viaggio in Italia einen wunderbaren Text. Es handelt sich hier um drei Kritiker der Cahiers du Cinema und dreimal um einen Film von Rossellini. Die Franzosen irren sich in der Sache weniger als die Italiener: Rossellini hat in der Tat den modernen Film erfunden.
Anstatt sich mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen, verfielen die Franzosen mit Leib und Seele der italienischen „Gegenwart“, analysierten sie und bildeten sich ihre eigenen Theorien zu ihr. Italien war ein Land in Trümmern, und seine Filmautoren waren bereit, Zerstörung und Wiederaufbau im Film festzuhalten, indem sie vom Alten (Visconti) zum Modernen (Antonioni) übergingen, ohne unterwegs die Vitalität des italienischen Volkes zu vergessen (Fellini). Im italienischen Spiegel haben die Franzosen (und nicht nur sie) gesehen, wie die Welt und der Film sich veränderten.
Aber selbst in diesem Spiegel standen die beiden beschriebenen Positionen einander gegenüber. Auf der einen Seite diejenigen, welche weiterhin „unmittelbar“ am Geschehen teilnehmen wollen und das Kino „benutzen“, um dem von der Vergangenheit in die Gegenwart führenden Faden auf der Spur zu bleiben. Auf der anderen Seite die, die verstanden haben, dass Geschichte immer mehr die Geschichte unserer Wahrnehmung ist, unseres täglichen Lebens, ohne vorgefasste Meinungen, ohne bewusste Gegenüberstellung von Gut und Böse. In den siebziger Jahren sind also die Bewunderer von La classe operaia va in paradiso (Elio Petri) nicht unbedingt die Fans von Dillinger é morto (Marco Ferreri).
Was geschieht, wenn man neugieriger auf die Geschichte seiner Nachbarn ist als auf die eigene? Es führt zu einer Art Vogelperspektive, einer erweiterten Vision, etwas abgehoben zwar, aber dafür umso hellsichtiger, um nicht zu sagen prophetischer. Bazin nimmt nur einen Teil von Rossellinis Erbe an, aber genau diesen Teil wird Godard erben, und es ist kein Zufall, wenn dieser 1963 die Idee zu Les carabiniers bei Rossellini findet. Bevor er lautstark von einem allgemeinerzieherischen Fernsehen träumt, spricht Rossellini im Flüsterton zu seinen Bewunderern über eine neue Art, sich mit der Frage „Film und Geschichte“ auseinanderzusetzen.
Der zweite Weltkrieg hinterlässt zwei Erbschaften, eine „klassische“ und eine „moderne“. Da sind einerseits die toten Zivilisten und Soldaten, die ausgebluteten Länder, die internen Abrechnungen, andererseits sind da aber auch die unaussprechlichen, inkommensurablen Ereignisse, die der Geschichte angehören und gleichzeitig dazu zwingen, das Konzept von Geschichte neu zu überdenken: Die Barbarei der Konzentrationslager ist in den „zivilisiertesten“ Ländern der Erde entstanden, und gleichzeitig fallen die ersten zwei Atombomben.
Die Filmschaffenden Frankreichs sind es (zumindest jene, die gespürt haben, wie ihnen die Medien mit allen Mitteln die Legitimation entziehen würden, ihrer alten und ehrenvollen Aufgabe der Geschichtsschreibung nachzukommen), welche am kompromisslosesten die Herausforderung dieser Art von „Geschichte“ angenommen haben. Sie waren ja davon befreit, an der kollektiven Trauer des französischen Volkes „arbeiten“ zu müssen (wie es zwanzig Jahre später die amerikanischen Filmautoren nach Vietnam zu tun verstehen werden). Sie haben auf kein grünes Licht gewartet, um ihre „Kunst“ (das Kino), Schritt für Schritt mit dem zu konfrontieren, worauf sie sich in ihrer Geschichte noch nie eingelassen hatte. Trotz Fehlens der Worte, um es zu sagen, der Bilder, um es zu zeigen, und der verbindenden Fäden, die das Ganze zusammenhielten.
Deshalb sind die ersten Filme von Resnais einzigartig. Nuit et brouillard ist der erste Film, der ausspricht, dass die Gefahr des Vergessens besteht, und das wir von nun an zwischen zwei Arten von Ängsten leben, nämlich derjenigen, zuviel zu vergessen, und derjenigen, zuviel daran zu denken.
Der französische Film ist von allen am ausgeprägtesten moraliste, weil er es verstanden hat, aus der konkreten Geschichte Fragen einer anderen Geschichte herauszukristallisieren. Der Geschichte der Menschheit, welche sich ihrem eigenen Vernichtungspotential gegenübergestellt sieht. Die traditionellen Figuren des „historischen Films“ verschwinden, was bleibt, ist eine leere Struktur, erschreckend und nackt. Es bleibt ein „neues“ Wissen, welches besagt, dass man weder als Henker noch als Opfer geboren wird, dass die Folter in der Regel eine „alltägliche“ Sache ist, und dass die Aufrichtigkeit, mit der Reden gehalten werden, über die wahre Natur der Absichten nichts sagt. Der Andere (jener „Andere“, der „ich“ sein kann) ist der unhistorische Held des neuen Films und der französischen Nouvelle Vague.
Nach jahrelangem Warten fangen die Kühnsten nun an, auf die Geschichte Frankreichs und die Schattenseiten dieser Geschichte zurückzukommen, ausgehend von den „neuen“ Fragestellungen. Marguerite Duras macht aus Hiroshima mon amour nicht ein psychologisches Dokumentardrama, sondern eine wahre, brennende, hochexplosive Anklage, einen der seltenen Filme, der die kahlgeschorenen Frauen während der Befreiung zeigt. Dies ist immer noch die Geschichte Frankreichs, sicherlich, aber nicht wie von Duvivier (oder später von Louis Malle) verfilmt: Sie ist verzerrt, chemisch neu zusammengesetzt. Sie will nichts „reparieren“ und sich mit nichts aussöhnen. Non reconciliés (Die Unversöhnten) ist übrigens der Titel eines Erstlings, von Jean-Marie Straub, welcher davon spricht, dass das Trauern des einzelnen lange währt.
Man wird einwenden, dass der französische Film mit dieser Art, sich mit Haut und Haaren in Metaphysik zu stürzen, es fertigbringt, auch weiterhin nicht über die französische Vergangenheit zu sprechen (und nur über sie nicht). Das stimmt. Bei soviel Universitalität wird das Problem entschärft, und die Gattung „Mensch“ gilt von nun an als jenes Wesen, „welches sich selbst nicht mehr erträgt.“
Es stimmt, dass man nur eine ganz bestimmte Trauer trägt, vorzugsweise die eigene. Das französische Kino hat in seinen grössten Sternstunden die triviale Geschichte Frankreichs umgangen, um an der ästhetischen Hypothese einer Welt nach der Geschichte zu schmieden.
Sie beginnt mit zwei Filmautoren, die sich eigentlich um Geschichte wenig Gedanken machten, mit zwei Erfindern namens Bresson und Tati. Was machen sie? Sie fangen wieder gänzlich bei Null an. Aber die Stimmen Bressons und die Geräusche Tatis sind nicht nur künstlerische Tricks, sie sind zu einem Zeitpunkt erfunden worden, wo Deklamieren und lautes Reden in einer Art üblich waren, die nur allzuleicht schlechte Erinnerungen wachrief.
Mit den Leuten der Nouvelle Vague kommt der Vorwurf, sie ersetzten die Geschichte (das heisst den Klassenkampf) durch ihre eigenen kleinbürgerlichen Probleme. Doppelter Tadel. Erstens, weil diese Generation - die durchschlagende Episode des Mai 1968 ausgenommen - nichts vergleichbares kennengelernt hat, was vorangegangene Generationen auf die Strasse getrieben, „provoziert“ hatte, und sie sich mit bestem Willen nur engagieren konnte, wenn sie ihre Heimat verliess (Godard in Palästina: Ici et alleurs; ein grosser, verkannter Film).
Ferner, weil sie die einzigen „Kriege“, welche in ihrer Umgebung stattfanden, auf ihre eigene Art angegangen ist: Krieg in der Paarbeziehung (die „Szene Ehe“ ist das zentrale Thema einer ganzen Menge schöner Filme der sechziger und siebziger Jahre, von L’amour fou zu La marna et la putain über Le mépris und Nous ne vieillirons pas ensemble), Kriegszustand des Individuums angesichts des „Anderen“ (Godard) und letzten Endes angesichts seiner selbst als unbekannte Persönlichkeit (Rohmer). Auf der Ebene des „Privaten“ erkennt man hier das italienische Erbe wieder, von Rossellinis Filmen mit Ingrid Bergmann bis zu Antonionis Filmen mit Monica Vitti.
Um diese französische Filmwelt in einem Wort zusammenzufassen, würde ich sagen, sie habe sich endlos dem Schaffen filmischer Verfahren des Zugangs zum anderen gewidmet. Filmische Verfahren, bei welchen nie vergessen wurde, dass Kino ein nicht-neutrales Instrument ist, durchaus ausgestattet mit eigener Macht und eigener Wirklichkeit. Die „Autorenfilmer“ sind vor allem Leute, welche - aus Moralismus oder Masochismus? - zu Dingen und Menschen, die sie filmen, in engem Bezug stehen. Deshalb lehnen sie alle den „Naturalismus“ ab, welcher dem Film ein Mittel bietet, zu neutralisieren, ja sie „natürlich“ erscheinen zu lassen.
Der Preis, den es dafür zu zahlen gilt, ist hoch. In anderen Ländern (im (Italien Pasolinis, im Deutschland Fassbinders, im Japan Oshimas und sogar im England Stephen Frears) fühlen sich die Filmschaffenden verpflichtet, den Zugang dem Verfahren vorzuziehen. Die Franzosen gehen nicht so weit. Alter, vierzigjähriger Verdrängungsmechanismus: Scheinbar sind sie unfähig den Kreis des „unter uns“ zu verlassen und den Anderen bildlich darzustellen. Als wäre es dafür zu spät.
Ist es zu spät? Zu spät für Frankreich, Europa, das Kino? Die „Geschichte des Films“ ist immer untrennbar gewesen von derjenigen der grossen öffentlichen Ereignisse des Jahrhunderts. Die Friedenszeit ist, seit vierzig Jahren, die Zeit des Aufschwungs des Fernsehens. Dieses hat keine Geschichte, es zeichnet emblemhaft auf und vergisst. Aber dennoch verlassen wir uns darauf, dass uns dieses Medium das „Neueste“ aus der Welt vermittelt. Dem Kino bleibt somit die Erinnerung, Empfänger dieser Geschichte gewesen zu sein, aber auch manchmal an seinem Platz versagt zu haben. Den grossen Selbstfeiern (vom Typ des „Césars“) bleibt also noch übrig so zu tun, als sei das Kino immer noch „in Phase“ mit der Geschichte (von Le dernier métro bis Au revoir les enfants).
Es ist nicht mehr möglich, à chaud, d.h. am Puls des Geschehens, Zeugnis abzulegen, wenn man die Dinge zu sehr hat „erkalten“ lassen. Diese Regel gilt auch für das Kollektiv. Die Sowjets zum Beispiel haben Bucharin zu rehabilitieren, ohne jedoch dabei mit allzugroßer Unterstützung von Seiten des Films rechnen zu können (jeder beliebige Artikel der Prawda ist interessanter als Repentir von Abouladze, welcher letztes Jahr in Cannes gezeigt wurde).
Was zeigt sich nun, wenn man auf den französischen Charakter im speziellen zurückkommt? - Dass jüngste Ereignisse (sprich Präsidentschaftswahlen 1988) ein unbekanntes Land mit sehr alten Strukturen aufdecken: ein Frankreich mit ernstzunehmenden Zügen der dreissiger Jahre. Mit einer dynamischen, extremen Rechten, einem nationalistischen Volkstum, einem geschrumpften, bolschewistisch gefärbten PCF und einem alten Mann, welcher für sich allein schon ein Kaleidoskop darstellt.
Was bedeutet dies? - Dass die beiden Irrenhauswärter des Nachkriegsfrankreich, de Gaulle und ein starker PCF, als Idealbilder weg sind vom Fenster, und dass das Nicht-Bild besorgniserregenderen und verstaubten Trugbildern gewichen ist. Zu exaltiert und hohl wurde die Résistance gepriesen, und in zu wenig Filmen erschien der PCF personifiziert (im Gegensatz zur italienischen Parallele). Resultat: Mit einem Mal zerbrach der sichernde doppelte Riegel, und das aktuelle Frankreich beginnt, Ähnlichkeiten aufzuweisen mit einem Frankreich, wie Renoir es filmte.
Aber kann sich das Kino heutzutage einen Renoir leisten?