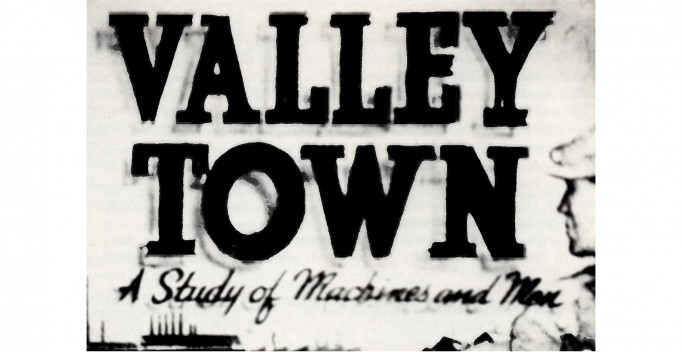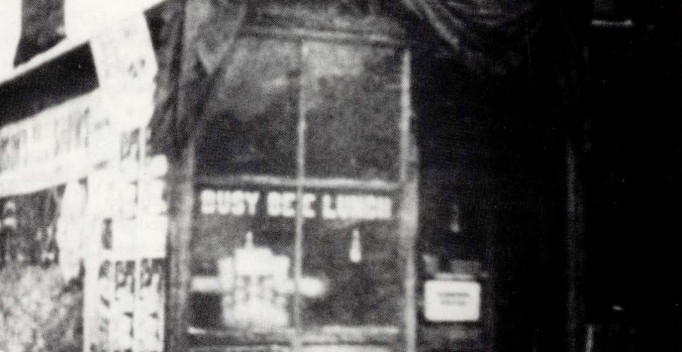Valley Town: A Study of Machines and Men wurde 1939 von Willard Van Dyke gedreht, als ein Dokumentarfilm mit aktuellem sozialkritischem Bezug und intensiver formaler Gestaltung. Heute ist dieser Film - wie so viele Werke der dokumentarischen Gattung - weithin unbekannt. Er wirkt fremdartig und merkwürdig, und er fordert die historische Analyse heraus, um den Zusammenhang zu rekonstruieren, aus dem er entstand. Originell und kontrovers war der Film zwar schon zum Zeitpunkt seiner Entstehung; aber er stand in einer lebendigen und bewegten Tradition, in der allenthalben mit dem Dokumentarischen und dem Medium Film experimentiert wurde. So war seine Merkwürdigkeit eine eher relative. Grundsätzlich wurde Willard Van Dykes Verständnis dessen, was einen Dokumentarfilm ausmacht, von vielen Filmemachern in den Vereinigten Staaten, Grossbritannien und anderen Ländern geteilt.
Im folgenden soll zunächst die Problematik des Dokumentarischen kurz Umrissen und auf die Theorie und Praxis der 30er Jahre bezogen werden.
Was man unter dem „Dokumentarischen“ verstehen soll, ist ja keineswegs evident, und ausserdem sind Begriff und Praxis dem historischen Wandel unterworfen.1 Fest steht eigentlich nur, dass der Dokumentarfilm eine andersartige, unmittelbarere Referenz zur Wirklichkeit aufweist als der Spielfilm. Doch sobald man entscheiden soll, ob und wie diese „Wirklichkeit“ dargestellt werden kann, kommt man in philosophische Seenot. Schon die Frage, ob ein authentischeres Bild entsteht, wenn das dokumentierende Subjekt sich heraushält und nach Objektivität strebt, oder aber dann, wenn es dem Werk seinen subjektiven Standpunkt einschreibt, hat die Theorie in zwei Lager geteilt.
Im allgemeinen wird der referentielle Bezug zur Wirklichkeit aus dem Aufzeichnungscharakter des Dokumentarfilms abgeleitet. Da der Film die Realität vor der Kamera mit technischen Mitteln abbildet, kann er ein Zeugnis davon konservieren, was sich zu einem bestimmten Augenblick, an einem bestimmten Ort zugetragen hat. Er fungiert, wie schon sein Name suggeriert, als Dokument. Die Leistung des Dokumentaristen besteht darin, erstens zum richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, um das Dokument zu erstellen, und zweitens, die Aufnahmen so zu montieren und zu präsentieren, dass ihr Kontext und ihre Bedeutung fassbar werden: das Dokument zum Film wird.
Im Zentrum dieser Auffassung vom Dokumentarischen steht die Vorstellung, der Film solle die Distanz zwischen Ereignis und Zuschauern überbrücken, um ihnen einen Augenschein von Situationen zu geben, denen sie nicht beigewohnt haben. Aber obwohl es stimmt, dass Kameras - und ebenso Mikrofone — analoge Aufzeichnungsinstrumente sind, die wiedergeben, was ihnen vorgesetzt wurde, ist der entstandene Augenschein nicht unproblematisch.
Ohnehin sind die meisten Aufzeichnungen nicht besonders aussagekräftig: Den Ereignissen ist ihre Bedeutung nicht auf die Stirn geschrieben; die Filmemacher bleiben an der Peripherie des Geschehens; das Wichtigste vollzieht sich hinter den Kulissen etc. Ausserdem müssen die Aufzeichnungsinstrumente dirigiert, eine Auswahl aus dem Geschehen getroffen werden, und so geschieht es unausweichlich, dass Bilder und Töne von persönlichen Entscheidungen, von der Subjektivität der Filmemacher geprägt sind. Zwei Filmemacher werden immer zwei verschiedene Dokumente erstellen, auch wenn beide um grösstmögliche Objektivität bemüht sind. Filmaufnahmen sind deshalb stets ambivalent, was ihre sogenannte „Objektivität“ angeht, auch wenn sie vom authentischen Schauplatz stammen.
Eigendefinitionen des Dokumentarfilms gehen daher nicht so absolut mit dem Anspruch der Authentizität und Objektivität um und sehen im Dokumentieren der Wirklichkeit nur eines seiner Ziele. Wenn sich Dokumentaristen von anderen nicht-fiktionalen Filmsorten, die ebenfalls Fakten präsentieren, abgrenzen wollen, so führen sie vor allem ihre Intention an: einen Bewusstseinswandel einzuleiten, der den sozialen Wandel zur Folge hat. Während der Industriefilm für Produkte wirbt, der Kulturfilm und der Lehrfilm Bildung vermitteln, der Nachrichtenfilm über Aktuelles informiert, wendet sich der Dokumentarfilm soziopolitischen und humanitären Problemen zu, die von der offiziellen Berichterstattung vernachlässigt werden. Es ist sein Ziel, gesellschaftliche Defizite aufzuarbeiten. Von den anderen faktenorientierten Verwendungsformen des Mediums Film unterscheidet er sich also weniger durch die authentische Genese seines Materials als durch sein Engagement. Seine Referenz zur Realität liegt vor allem darin, auf diese Realität zurückzuverweisen. Es geht dem Dokumentarfilm darum, die Sicht der Zuschauer auf die Welt durch den Augenschein zu verändern, den er bietet.
Für diesen Augenschein haben möglichst ungestellte Bilder natürlich den Vorteil der Plausibilität. Sie wirken als Indizien und können oft intensiver überzeugen als Worte - auch wenn ihr Indizcharakter, wie schon ausgeführt, nicht frei von Fragwürdigkeit, von Subjektivität und Manipulation ist. Doch oft ist für den Augenschein auch die konstruierte Darstellung der Wirklichkeit geeigneter als die authentisch gewonnene Aufzeichnung. Auch sie vermittelt ja ein „wirkliches“, fotografisches Bild, dem der Überzeugungscharakter des Dokuments noch anhaftet, ohne dass sie mit dessen Zufälligkeiten, visueller Insignifikanz oder mangelnder inhaltlicher Zentrierung zu kämpfen hätte.
Befreit von den gegebenen Zwängen der realen Situation und unabhängig von praktischen Hindernissen lässt sich das Typische und Bedeutsame eines Ereignisses oft besser, ausgereifter und sinnfälliger destillieren.
Für die meisten Dokumentaristen ist es daher zulässig, die Wirklichkeit für ihre Zwecke einzuspannen und umzugestalten: Zum Beispiel, indem sie den Film achronologisch aus Fragmenten zusammenfügen, die ihren Sinn erst aus dem neuen Kontext beziehen; oder indem sie Situationen arrangieren, Personen vor der Kamera aufeinanderstossen lassen, die sich sonst nicht begegnet wären; oder indem sie Interviews führen, bei denen sie bestimmte Aussagen provozieren; oder aber indem sie Ereignisse, die sie verpasst haben, nachstellen oder sogar neu inszenieren. All dies braucht keine Täuschung oder Verfälschung zu beinhalten und gehört für viele Dokumentaristen zu den selbstverständlichen Methoden.
Für andere sind dagegen solche Eingriffe oder Arrangements gänzlich unzulässig. Sie gehen puristisch vor und lassen nur Aufnahmen von solchen Ereignissen gelten, die sich ohne Zutun oder sogar Anwesenheit des Kamerateams genauso zugetragen hätten - soweit sich das abschätzen lässt. Der äusserste Pol dieser dokumentaristischen Richtung arbeitet mit Teleobjektiv oder verdeckter Kamera - eine Praxis, die jedoch Probleme der Menschenwürde aufwirft, weil sie einen voyeuristischen Eingriff in die Selbstbestimmtheit des gefilmten Subjekts bedeutet. Beide dokumentarischen Extreme (die Nachinszenierer und die Kameravoyeure) können Legitimationen für sich und ethische Vorwürfe gegen die anderen ins Feld führen: Die theoretische Situation ist also ziemlich komplex, und dies in nuce auch für alle Positionen, die zwischen den Extremen liegen.
Das Verständnis eines gegebenen Dokumentarfilms oder einer dokumentarischen Richtung beginnt mit der Einordnung auf der Skala der möglichen methodischen Positionen. Aus ihnen ergeben sich Konzept und Arbeitsweise im einzelnen. - Für die Dokumentaristen der 30er Jahre war die Skala der Methoden allerdings noch kleiner, als sie sich heute darbietet, und sie war durch ideologische und praktische Faktoren aller Art determiniert. Es soll im folgenden darum gehen, welche Möglichkeiten und Intentionen der amerikanische Dokumentarfilm der 30er Jahre hatte und auf welche spezifischen Weisen sein Bezug zur Realität oszilliert.
Paradoxerweise haben die Dokumentaristen der 30er Jahre einerseits das Wort „documentary“ für ihre Werke gewählt - also die dokumentierende, aufzeichnende Seite des Mediums betont (obwohl es ihnen noch freigestanden hätte, sich anders zu nennen, denn der Begriff war so neu wie die Sache selbst). Andererseits haben sie jedoch nach Massgabe ihrer Absichten relativ grosszügig darüber entschieden, welche filmische Methode zu wählen sei, ob sie Dokumente des Wirklichen präsentieren wollten oder gestaltete Bilder mit intensivem Wirklichkeitsverweis. Für heutige Begriffe ist es fast schockierend, wie klein der Prozentsatz an Szenen war, die tatsächlich aus dem Fluss des Lebens aufgezeichnet wurden, und wie gross der Prozentsatz, der inszeniert oder in der Montage überhaupt erst kreiert wurde.
Eine dokumentarische Tradition oder Schule gab es in den USA zunächst nicht. In den frühen 30er Jahren standen sehr verschiedene Formen des Dokumentarischen sozusagen naturwüchsig nebeneinander: Lyrische Filme mit Kunstanspruch, die man heute zu den Experimentalfilmen zählen würde; Reiseberichte aus exotischen Ländern mit didaktischen und kulturkritischen Momenten, die die Ansätze Robert Flahertys aus den 20er Jahren weiterentwickelten; pragmatisch zusammengeschusterte, bewusst kunstlose „battle footage“ der Workers’ Film and Photo League mit Aufzeichnungen von für die Arbeiterbewegung relevanten Ereignissen, die der politischen Agitation dienten; Regierungsfilme, die gesellschaftspolitische Massnahmen erläutern und vorbereiten sollten; und schliesslich kommerziell produzierte Wochenschauen, die in den Kinos liefen.2 Hinzu kamen Anstösse von ausserhalb der USA, insbesondere aus dem russischen Revolutionsfilm, aber auch aus Frankreich, Deutschland und vor allem England. Und ausserdem existierte eine sozialdokumentarische fotografische Tradition, die durch Regierungsaufträge im Zuge des New Deal intensiviert wurde.3 - Teilweise aus diesen Formen, teilweise parallel oder in Opposition zu ihnen entwickelte sich dann, um die Mitte der 30er Jahre, das eigentliche movement des sozialkritischen amerikanischen Dokumentarfilms.
Diese Bewegung hat sich auch theoretisch artikuliert — in Manifesten, Kritiken, Vorträgen sowohl wie in rückblickenden Texten der Beteiligten.4 Federführend waren dabei zunächst englische Dokumentaristen - allen voran John Grierson5 und Paul Rotha -, wie sich die englische Bewegung überhaupt etwas früher konstituiert hat als ihre amerikanische Parallele. Aber beide Bewegungen standen im Austausch miteinander und waren international durchlässig, und die englische knüpfte ebenso an den Filmen des Amerikaners Robert Flaherty und dem Vorbild des russischen Agitationsfilms an wie die amerikanische. Beiden gemeinsam waren ausserdem bestimmte politische und moralische Grundsätze, aus denen sich ihre Motivation, Filme zu machen, speiste. Es ist deshalb sicher zulässig, das berühmte, 1935 von Raul Rotha formulierte Manifest des Dokumentarfilms, „Some Principles of Documentary“6 auch für die Amerikaner sprechen zu lassen.
Nach Rotha ist es die Hauptaufgabe des Dokumentaristen, die Bevölkerung mit ihren eigenen gesellschaftlichen Problemen zu konfrontieren: „This is a job of presenting one half of the populace to the other.“ Dazu, so führt er aus, reiche die Beschreibung und Beobachtung der Zustände nicht hin. Der Dokumentarfilm müsse zu den gesellschaftlichen Zusammenhängen vorstossen, und er müsse seine Analyse so weit treiben, dass er Schlussfolgerungen für die Praxis der Zuschauer auslöse.
Diese Aufgabe sei eine kreative, sie verlange „a high creative endeavor“. Unter solcher Kreativität versteht Rotha nicht nur lebendige Energie und Einfallsreichtum, sondern Kunst im emphatischen Sinne des Wortes: poetische Kommentare beispielsweise, aber auch nach ästhetischen Kriterien komponierte Bilder. Die Angst vor der Ästhetisierung und damit Bändigung und Entrückung der Welt, die heute die dokumentarische Diskussion durchzieht, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht fühlbar. Gleichzeitig empfiehlt Rotha, das filmische Material zuzuspitzen und zu dramatisieren. Nur dann könne es seine latente Bedeutung preisgeben, seinen Dienst erfüllen, auch wenn man damit gegen das Prinzip der Authentizität verstossen müsse:
The essence of the documentary method lies in its dramatization of actual material.
The very act of dramatizing causes a film statement to be false to actuality. We must remember that most documentary is only truthful in that it represents an attitude of the mind. The aim of propaganda is persuasion, and persuasion implies a particular attitude of the mind ...
Der Unterschied des Dokumentarfilms zum Spielfilm wird also nicht primär in der Methode gesehen, sondern in der Mission. Im Bestreben, die Zuschauer für revolutionäre und humanitäre Ziele zu gewinnen, kommt im Grunde jede Art der formalen Gestaltung in Betracht. Allerdings schliesst Rotha mit der Bemerkung:
It has so far been found that the best material for documentary purpose is naturally, and not artificially contrived.
Es ist bezeichnend, dass Rothas Programm mit einer solchen Verbeugung vor der ungestellten Aufnahme endet.
Es ergibt sich also aus diesem theoretischen Fundament des Dokumentarfilms - und kennzeichnet seinen unverwechselbaren Stil in den 30er Jahren -, dass er den Augenschein des Wirklichen zwar sehr ernst nimmt, die Ereignisse aber meist nicht im Rahmen ihres natürlichen Zusammenhangs und in direkter Zeugenschaft aufnimmt, sondern sie nachträglich oder andernorts für die Kamera arrangiert. Man verfuhr hier zweckmässig, ohne Vergötterung der Einmaligkeit des historischen Augenblicks. Allerdings folgt die Nachinszenierung andern Gesetzen, als sie im Spielfilm üblich sind: Statt Schauspieler zu engagieren, bittet man die Betroffenen, sich selbst zu verkörpern, ihre eigene Aktion zu wiederholen oder aber Aktionen auszuführen, die im Rahmen ihrer persönlichen und situativen Möglichkeiten gelegen hätten - sich also ihrem Typus getreu zu verhalten und ihre eigene Situation zu repräsentieren.7 Und man plaziert die Personen in ihrem authentischen environment, so dass die Gegenstände mitspielen können.
Was bei solchem Vorgehen entstehen soll und entsteht, ist eine leicht überhöhte, stilisierte Authentizität. Das Zufällige ist weitgehend aus den Aufnahmen gebannt und hat dem Plausiblen Platz gemacht, so dass Ambivalenzen und Missverständlichkeiten getilgt sind. Stattdessen sind die Bilder ästhetisch und symbolisch angereichert, sei es durch Plazierung sinnstiftender Attribute, sei es durch Wahl der wirksamsten Wetterlage und Beleuchtung, sei es durch intensivierende Bildkompositionen, die den gezeigten Verhältnissen wie von selbst zuzuwachsen scheinen. Ebenso wichtig wie die Aufnahme ist die Montage des Materials, mit der die Argumentation noch weiter auf den Punkt gebracht wird. Meist simultan mit der Montage entstehen Kommentar und Musik, so dass eine dokumentarische Sequenz dieser Zeit nicht notwendig vom visuellen Ausgangsmaterial dominiert wird, sondern auch häufig die Bilder den Erfordernissen und Impulsen der Musik unterstellt sind. Der Appell an den Verstand der Zuschauer wird unterstützt durch eine konsequente Mobilisierung der Emotionen.
Damit ist der sozialkritische Dokumentarfilm der 30er Jahre der manipulativen Propaganda sehr nahe gerückt (auch wenn Paul Rotha den englischen Begriff „Propaganda.“ noch unbefangen und positiv gebraucht). In seinen schlechteren Produkten unterscheidet er sich kaum von ihr; in seinen besten aber wird der Manipulation durch die Integrität der Argumentation entgegengesteuert. Die Glaubhaftigkeit der Darstellung und Überzeugungskraft der implizierten Folgerungen für die Verhaltensweise des Publikums erwächst aus der moralischen Berechtigung der Ziele. Die integren Absichten der Filmemacher sind dabei nicht nur ablesbar an der Tatsache, dass sie nicht kommerziell orientiert sind, sondern gleichermassen an der Passion, der Intensität, mit der sie sich ihrem Projekt widmen. So ist die kreative ästhetische Gestaltung kein Beiwerk der Filme, sondern Indiz und Garant der Dringlichkeit ihres Anliegens, das zum Gelingen des Plädoyers beiträgt.8
Sowohl Paul Rothas Manifest wie die dokumentarischen Werke der Epoche werden besser verständlich, wenn man in Rechnung stellt, welche technische Ausrüstung damals zur Verfügung stand. Viele methodische Entscheidungen entspringen ja der Arbeitsweise.
Schon damals waren zum Beispiel handliche 16mm-Kameras entwickelt, aber es gab kaum öffentliche Vorführmöglichkeiten für den Schmalfilm. Für Dokumentaristen, die eine breitere Öffentlichkeit ins Auge fassten, war es deshalb angezeigt, das 35mm-Format zu wählen. Diese Entscheidung hatte Vor- und Nachteile: 35mm war zwar sehr viel schwerfälliger und teurer als 16 mm, bot dafür aber eine überlegene Bildästhetik und gute Tonqualität. Ausserdem war die Montage handwerklich einfacher.9
Es ist weiterhin wichtig zu wissen, dass dem Dokumentarfilm in den 30er Jahren noch keine Synchronton-Aufzeichnung möglich war — obwohl der Synchronton in Hollywood schon seit Ende der 20er Jahre die Regel war. Aber für das Budget und die Produktionsweise der Dokumentaristen lag die Ton-Technologie noch ausser Reichweite. Die Filmaufzeichnungen entstanden daher stumm und wurden später, am Schneidetisch, nachvertont. Auch der Farbfilm bot sich noch nicht als Alternative zum Schwarzweiss an. Einmal wäre er viel zu teuer gewesen, zum andern verband man damals mit der Farbe (im Spielfilm) noch die Konnotationen „luxuriöse Unterhaltung“ oder „Phantastik“.10 Das sollte sich erst im Verlauf der 40er Jahre ändern.
Und schliesslich gab es noch kein Zoomobjektiv, das heute aus der Dokumentarfilmpraxis kaum mehr wegzudenken ist, weil es den Filmemachern erlaubt, mit flexibler Distanz zum Objekt zu arbeiten. Im modernen Dokumentarfilm, seit den 60er Jahren, ist der Blick der Kamera sehr mobil geworden, ohne dass die Kameraleute ihren Standpunkt verlagern müssen. Viele Limitationen früherer Epochen sind durch den Zoom entfallen.
Bereits durch diese technischen Voraussetzungen hielt der Dokumentarfilm der 30er Jahre eine gewisse Distanz zum Fluss des Lebens. Weder konnte man sich mit der Kamera in der Hand quer durch das natürliche Geschehen bewegen, noch konnte man den Originalton der Wirklichkeit mit erfassen. Es lag also nahe, sich auf die Vorteile der gegebenen Apparatur zu besinnen: lieber mithilfe einer sorgfältig gewählten Bildkomposition, also relativ fotografisch-statisch zu arbeiten, um später über die Montage, vor allem aber über den Ton, Bewegung in den Film zu bringen. Marc Blitzstein, der Komponist der Musik zu Valley Town, hat in der „Galvanisierung“ der Bilder seinen wichtigsten Beitrag zum Film gesehen.11
Als das Projekt Valley Town: A Study of Machines and Men 1939 in Angriff genommen wurde, hatte der sogenannte „klassische“ Dokumentarfilm der USA schon den Höhepunkt seiner Möglichkeiten erreicht. Zahlreiche originelle und passionierte Werke waren entstanden, verschiedene politische und ästhetische Gruppierungen hatten sich gebildet, erfahrene Künstler und Techniker standen zur Kooperation bereit. Der verantwortliche Filmemacher von Valley Town, Willard Van Dyke, hatte bereits bei dem von der Regierung in Auftrag gegebenen Film The River (Pare Lorentz, 1936) die Kamera geführt und sowohl auf dem Gebiet der Fotografie wie der Theaterregie Erfahrungen gesammelt. Unmittelbar vor Valley Town hatte er, zusammen mit dem Fotografen und Filmemacher Ralph Steiner, den berühmten Dokumentarfilm The City realisiert, der zwei Jahre lang auf der New Yorker Weltausstellung lief und der Gattung zum Massendurchbruch verhalf. Bereits erfahren waren auch die Kameraleute von Valley Town, Roger Barlow und Bob Churchill. Irving Lerner, der den Schnitt besorgte, und Ben Maddow, der Autor des Kommentars, zählen beide zum zentralen Kreis der zeitgenössischen Dokumentarfilmbewegung. Über den Komponisten, Marc Blitzstein, wird weiter unten noch zu sprechen sein.
Valley Town war, wie die meisten Dokumentarfilme der 30er Jahre, eine Auftragsarbeit.12 Er wurde von der Sloan-Foundation für die New York University gefördert, mit dem Ziel, ihn in einer Reihe anderer Filme zur Problematik technologisch bedingter Arbeitslosigkeit als Anschauungs- und Informationsmaterial einzusetzen. Valley Town hat die Probleme einer amerikanischen Kleinstadt zum Thema, die ganz von der Stahlverarbeitungsindustrie lebte und durch Rationalisierungsmassnahmen plötzlich mit dem sozialen Elend entlassener Facharbeiter konfrontiert war. Der zentrale Reibungspunkt, die inhaltliche Motivation des Films, ist die Tatsache, dass hochqualifizierte Fachkräfte unvorbereitet ihren Arbeitsplatz verloren, weil weder die Firmenleitung noch die Regierung sich verantwortlich fühlten, diese strukturbedingte Krise abzufangen.
Van Dyke folgte einem Konzept der Emotionalisierung und Analyse - in dieser Reihenfolge. Es war ihm wichtig, die Ursachen des sozialen Elends herauszuarbeiten, aber noch wichtiger, eine Beziehung zwischen den Problemen der Arbeitslosen und dem Publikum zu stiften: Anteilnahme und Verständnis der einen Hälfte der Bevölkerung für die andere, wie Paul Rotha es gefordert hatte. Im Programm des Films ging es um folgende Punkte: Die desolate Tage des betroffenen Ortes zu veranschaulichen; den Umschlag von der Prosperität in die Not als von aussen verursachte Katastrophe zu kennzeichnen; die entlassenen Arbeiter als Amerikaner zu charakterisieren, deren spezifische Tüchtigkeit ausser Frage stand; das Elend nicht nur aus der Arbeitsplatz-Situation aufzurollen, sondern auch in seiner Bedeutung für das Selbstwertgefühl und die Familien der Betroffenen; und schliesslich einen Schritt in Richtung Abhilfe zu skizzieren, die kollektiv zu leisten wäre.
Willard Van Dyke verliess sich bei der Erfüllung dieses Programms stark auf die eindringliche Kraft der Fotografie, die insbesondere mit authentischen, ausdrucksstarken Gesichtern operierte. Diese Gesichter ebenso wie die gezeigten Situationen sollten als Identifikationsangebot fungieren - gestützt von einem Kommentar, dessen subjektivierende Strategie hinter die Oberfläche der Bilder führt. Als drittes Hauptelement und emotionalisierender Faktor war die eigens für den Film komponierte, innovative Musik vorgesehen.
Bei der Konzeption des Kommentars entschloss sich Van Dyke, von einem belehrenden oder rhetorisierend-poetischen Text - der sogenannten „Voice of God“,13 wie sie damals üblich war - abzusehen, um stattdessen einen fiktionalen Bürgermeister über das Elend in seiner Stadt reflektieren und die Zuschauer durch den Film führen zu lassen. Van Dyke war über eine Hörspiel-Serie, eine der beliebten Radio Soap Operas der Zeit, auf diesen Gedanken gekommen, da ihm einer der Sprecher, der Schauspieler Ray Collins, in der Rolle eines Kleinstadt-Honoratioren eingeleuchtet hatte. Ray Collins war Mitglied des Orson-Welles-Ensembles (und spielt in Citizen Kane die Rolle des politischen Widersachers).
Valley Town wird also durch die Ichstimme eines fiktionalen Stadtvaters strukturiert, dessen sympathische Fürsorge sich beispielgebend auf die Haltung der Zuschauer auswirken soll. Schon in dieser Hinsicht arbeitet der Film also mit einer Konstruktion, die keine authentische Grundlage hat und stark an die Gefühle appelliert. Es ist jedoch keine Täuschung der Zuschauer beabsichtigt, niemand wird den Text für die Worte eines echten Bürgermeisters halten. Denn der Kommentar wechselt flexibel zwischen lyrisch-reflexivem, informativem und appellativem Register, und er kommt und geht je nach den Erfordernissen der restlichen Elemente des Films.
Was die Bilder angeht, so steht Valley Town eindeutig in der Tradition der sozialdokumentarischen Fotografie der 30er Jahre. Statische, geometrisierte Einzelbilder von verwaistem Gerät und erstorbenen Anlagen, die den Verfall dokumentieren und nach allen Regeln der Bildkomposition und Stimmungsfotografie erstellt sind,14 wechseln ab mit handgehaltenen Aufnahmen, die Facharbeiter bei ihrer virtuos aufeinander abgestimmten Arbeit zeigen oder Szenen auf dem Weg durch den Ort. Am eindringlichsten sind die Alltagsaufnahmen von Personen: ein blasses, kränkliches Kind allein hinter dem Fenster eines heruntergekommenen Hauses; Arbeiter an der Theke eines diner, die ihre Thermosflaschen mit Kaffee füllen lassen; eine deprimierte Familie beim ärmlichen Abendessen; und immer wieder Gesichter von Arbeitslosen, meist schweigend, verschlossen, in einer Mischung aus Verzweiflung und Würde.
Es sind diese Gesichter, die in erster Linie das Prädikat „authentisch“ verdienen. Willard Van Dyke hat die Personen unter den Arbeitslosen am Drehort sozusagen handverlesen und sie gebeten, sich selbst darzustellen. Eine Texttafel im Vorspann gibt kund: „The people in this film are not actors. They are men and women of an American town.“ Dabei wurde den „Darstellern“ szenisch nicht viel mehr zugemutet als ihre normale Präsenz im Alltag. Die meisten werden eher fotografiert als gefilmt, und die Filmemacher drängen sich nicht auf, auch wenn es zu Grossaufnahmen kommt. Es besteht fast kein Unterschied zwischen der Art, wie die Gegenstände, die Architektur des Ortes aussagekräftig ins Bild kommt, und der Art, wie die Menschen respektvoll, aber genau und funktional eingesetzt sind.
Signifikant ist auch, dass die Personen weitgehend entindividualisiert werden, ein Gesicht immer wieder anderen Platz macht. Dies entspricht dem Programm des Films, nichts Persönliches zu zeigen, sondern sich auf das Typische einzulassen, wie schon der Titel, Valley Town: A Study of Machines and Men, ankündigt. Eine Stadt dieses Namens gab es nicht, ohnehin wurde an mehreren Orten gedreht,15 deren Verschmelzung im fertigen Film jedoch nur auffällt, wenn man ihn genauer analysiert. Eine Sequenz nämlich illustriert die frühere Prosperität von Valley Town, die Zeit vor der Arbeitslosigkeit, und diese Sequenz stammt von einem anderen Schauplatz. Es ist bezeichnend für den Umgang des Films mit der Authentizität, dass er es sich gestattet, in die - für ihn eigentlich unfilmbare - „Vergangenheit“ zurückzutauchen, diese Vergangenheit jedoch andernorts aufnimmt. Zwar sind die Bilder dort (vermutlich) ungestellt, aber ihre geografische Verpflanzung gibt ihnen dennoch etwas Irreales, Inauthentisches, jedenfalls für solche Zuschauer, die den Zusammenhang kennen und durchschauen.
Neben der Stimme des fiktionalen Bürgermeisters und gelegentlichen Aussagen der Arbeiter, die lippensynchron nachvertont sind und daher kurz gehalten werden, ist die Tonspur von der innovativen Musik Marc Blitzsteins geprägt. Blitzstein war von Eisler und Schönberg beeinflusst, arbeitete aber musikalisch weniger rigoros-radikal als diese, eher wie ein amerikanischer Kurt Weill (den er auch kannte): Anklänge an das Songtheater der 20er Jahre und Jazz-Elemente kennzeichnen seinen Stil, der zwar auch chromatisch und gelegentlich atonal verfährt, den harmonischen Unterbau aber nicht ganz verlässt. Neben einem spätromantischen Gestus finden sich auch minimalistische Maschinenrhythmen, wie sie in der Neuen Musik und besonders der Neuen Filmmusik üblich sind.
Marc Blitzstein war bereits durch ein musikalisches Bühnenwerk hervorgetreten, eine Art sozialkritische Arbeiteroperette mit dem Titel The Cradle Will Rock, die 1937 - mit einem Eklat - von Orson Welles uraufgeführt worden war.16 Ähnlich wie viele andere Komponisten der Zeit - Virgil Thomson, Aaron Copland, Hanns Eisler, Arthur Honegger, Edmund Meisei oder Benjamin Britten - interessierte ihn das „Documentary Movement“ und die Möglichkeit, an der kreativen Gestaltung eines Films massgeblichen Anteil zu haben. Van Dyke bezog ihn schon früh in den Produktionsprozess ein und war bereit, seine Konzeption auf Blitzsteins musikalische Ideen abzustimmen. Während der Montage stand ein Klavier im Schneideraum,17 so dass man Bild- und Tonrhythmus, Kommentar und Musik simultan und in engster Verbindung entwickeln konnte:
In the introductory reel of Valley Town, writer and composer worked so closely together that full phrases of music and of commentary (the documentary film’s 'dialogue') dovetailed in an alternating planned continuity. The sound of, and, more importantly, the significance of the words gained musical meaning and the music really collaborated without receding to accompaniment.18
Der kühnste formale Augenblick von Valley Town und der Moment, an dem Blitzstein und Van Dyke am intensivsten zusammengearbeitet haben, ist jedoch eine inszenierte Sequenz, die den Alltag eines Arbeitslosen und seiner Familie zeigt. Sie folgt - als vorletztes Segment des Films - auf eine Passage, in der man eine auf Automation umgestellte, fast menschenleere Fabrikanlage sieht. Im Kontrast zu dieser Stelle, die den Arbeitsprozess anonym-dokumentarisch beobachtet, fühlt sich der Film nun in einen einzelnen Arbeiter ein, der deprimiert, nach einem weiteren Tag ergebnisloser Stellensuche, nach Hause kommt.
Die Kamera begleitet den Mann auf dem Weg durch die zerfallenden Bretterhäuser, an Autowracks, einem streunenden Hund und den verstummten Nachbarn vorbei. Gleichzeitig ertönt eine Art innerer Monolog, in leicht rhythmisiertem Rezitativ, den man ihm aufgrund von Grossaufnahmen und Kameraperspektive bruchlos zuordnen kann. Über die dokumentarische Ebene legt sich mit zunehmender Intensität eine fiktionale:
What am I going home for? What the devil am I going home for? Just to walk in the door, to say „no job again“? ...
Der Arbeitslose betritt sein Heim, setzt sich zum Essen. Ohne Worte erkennt seine Frau, dass er wiederum erfolglos war. Die Perspektive wechselt zur Frau, ihr innerer Monolog löst den seinen ab. Während sie das Abendessen ausgibt und die Kamera wie im Spielfilm zwischen Mann, Frau und kleiner Tochter hin- und hergeht, hört man ihre Stimme - aber nicht als leise gesprochenen, depressiven Text, sondern als eine Art Arie gesungen:
You add up the pennies,
Finding there’s always just not enough.
So far you can eat,
And over your head is some kind of roof.
Oh, far away, there’s a place With work and joy and cheer,
Far away, oh far away from here.
Was an dieser Stelle formal geschieht, geht deutlich über das übliche dokumentarische Nachstellen typischer Situationen hinaus und hat auch schon seinerzeit Kontroversen ausgelöst.19 Nicht etwa weil die Fiktionalisierung und Operettenhaftigkeit misslang, sondern weil so plötzlich und einschneidend zu einer anderen Form gefunden wird, die dem dokumentierten Alltag nicht vorhersehbar adäquat ist: Eine Elegie über das Haushaltsgeld und Ausdruck einer Paradiessehnsucht, wie sie mit The Wizard of Oz (Victor Fleming, 1939) und Judy Garlands Lied „Over the Rainbow“ populären Ausdruck gefunden hatte, hier jedoch in der bitteren Wirklichkeit einer Armeleuteküche verankert bleibt. Für die Filmemacher hiess das Segment „the Blues sequence“,20 in Anlehnung an die traditionelle Klagefunktion dieser Musik. Eine solche Vermischung von Dokumentarischem und liedhaftem Selbstausdruck hatte es im Film noch nicht gegeben.
Betrachtet man die Art der Fiktionalisierung, die Valley Town einschlägt, so ist der Abstand zum Hollywood-Kino und damit zur Grenzüberschreitung in einen illusionären Darstellungsmodus ziemlich gross.21 Die Familie, deren Alltag gezeigt wird, bleibt im dokumentarischen Rahmen des übrigen Films - sie zählte zum Kreis der authentisch Betroffenen und spielte sich selbst, soweit sie überhaupt spielt. Denn der szenische Zusammenhang, die eigentliche Fiktionalisierung wird ja weniger durch ihre darstellerische Arbeit geleistet als vielmehr durch die inneren Stimmen.
Akustisch verlässt der Film allerdings die Ebene der Laiendarstellung, die zugeordneten Stimmen sind professionell geschult. Aber da Tonspur und Bildspur separat gestaltet sind und mit der Wendung ins Private eine radikale Subjektivierung einhergeht, kommt es nicht zu der realistisch-illusionären Verschmelzung von Stimme und Abbild, die für den Spielfilm die Norm bedeutet.22 Im amerikanischen Kino der 30er Jahre gibt es zwar gewisse Parallelen: In der Tradition von Musical und Filmoperette können Personen ihr Inneres durch Gesang offenbaren. Auch dass sie zunächst rhythmisch rezitieren, um erst allmählich in musikalische Ekstase zu geraten, kommt vor. Aber erstens darf man nicht übersehen, dass es sich in diesen Fällen um die leichte Muse handelt und dass ähnliche Formen nicht über die Genregrenzen hinweg — in das Melodrama oder den Gangsterfilm - Vordringen. Vor allem aber ist im Hollywood der Zeit unabdingbar, dass die singenden Personen selbst singen, die illusionäre Einheit von Bild- und Tonspur also gewahrt bleibt.
In Valley Town wird das Zusammenspiel dagegen als Artefakt bewusst gemacht, ähnlich einem Sketch oder einer narrativen Ballade, deren fiktionaler Status schwächer ausgeprägt ist als ihr didaktischer oder lyrischer. Ausserdem bleibt die Prototypik der Familie trotz der inneren Monologe gewahrt. Unser Einblick in ihr Leben hat statischen Charakter, aus dem sich keine fiktionalen Erwartungen auf den Fortgang der Geschichte knüpfen oder Rückschlüsse auf die Individualität der beiden Personen und ihrer Kinder ziehen lassen. Insofern kann die gesetzte dokumentarische Aufgabe - die empathische Erfahrung der Situation, nicht der Subjekte - als durchaus verwirklicht gelten, wenn auch mit ungewöhnlichen Mitteln.
Dennoch bleibt zu fragen — und dies nicht nur anhand der „Blues“-Sequenz -, ob die agitatorische Aufgabe des Dokumentarfilms sich in Valley Town nicht zu sehr ins Emotionale und Elegische verlagert. Die analytische Leistung des Films, die ursächlichen gesellschaftlichen Zusammenhänge der Arbeitslosigkeit zu erfassen, ist nicht allzu weit getrieben, Anklage und Forderung halten sich in gemässigten Grenzen. Sicherlich zählt Valley Town in der Tat nicht zu den aggressiv politischen, marxistisch inspirierten Dokumentarfilmen der Epoche. Aber zu seiner Bewertung muss mitgedacht werden, dass im Klima des voranschreitenden New Deal der Typus einer patriotisch-affirmativen, zu kollektivem Bewusstsein mehr als zu revolutionären Taten aufrufenden Agitation ihren begründeten politischen Platz hatte. Denn das Vertrauen auf die soziale Vernunft der Regierung und der Demokratie wurde durch zahlreiche öffentliche Programme genährt.23 Filme wie Valley Town sollten den Boden bereiten für Reformen, nicht für den Umsturz; sie waren engagiert humanitär in ihrer ideologischen Ausrichtung, weil man an diese Wurzel sozialen Handelns glaubte.
Im Lichte dieser Ausrichtung verblüfft es umso mehr, dass Valley Town auf dezidierte Ablehnung seiner Sponsoren stiess.24 Alfred P. Sloan, der der finanzierenden Stiftung Vorstand, war zwar der Präsident von General Motors und damit der höchstdotierte Funktionär der amerikanischen Industrie; doch die Stiftung hatte ja einen Film zum Thema „technologisch bedingte Arbeitslosigkeit“ in Auftrag gegeben, hatte Filmemacher aus dem Umkreis der Dokumentarfilmbewegung engagiert und das vorgelegte Konzept gebilligt. Es ist interessant, an welchen Punkten des fertigen Werks sich die Auftraggeber nun rieben:
Insgesamt erschien ihnen der Film zu pessimistisch - und deshalb unpatriotisch. So verlangten sie an diversen Stellen eine Entschärfung der düsteren Bilder ebenso wie des Bürgermeister-Kommentars. Nicht der Höhepunkt der lokalen Depression sollte gezeigt werden, sondern schon der Ansatz ihrer Überwindung, der Augenblick aktiver Hoffnung - auch wenn sich am Drehort noch kein Silberstreif abgezeichnet hatte. Gleichzeitig protestierte man gegen den dringlichen Klang der weiblichen Singstimme - sie sollte durch eine harmonischere, versöhnlichere ersetzt werden. Unter keinen Umständen sollte den Zuschauern suggeriert werden, dass die soziale Rücksichtslosigkeit der amerikanischen Industrie den traditionellen Pfeiler der Gesellschaft, die Ehe, dadurch gefährdete, dass die Männer ihre Familien nicht mehr ernähren konnten.
Sehr zu seiner späteren Reue und Beschämung hat der Filmemacher Willard Van Dyke den Änderungsdiktaten der Sponsoren stattgegeben,25 den Film tatsächlich entschärft und um optimistischere Passagen ergänzt. Der Komponist Marc Blitzstein dagegen fühlte seine Integrität durch diese Kompromisse verraten und kündigte die Mitarbeit auf. Der revidierte Film überzeugte niemand. Aber ohnehin war die Thematik der Arbeitslosigkeit bald durch den kriegsbedingten Wirtschaftsboom überholt.
Später wurde Valley Town in seiner ursprünglichen Gestalt restauriert und wird heute nur noch in der Urfassung verliehen.26 Eine letzte Kopie der Kompromissversion liegt im Archiv der New York University.