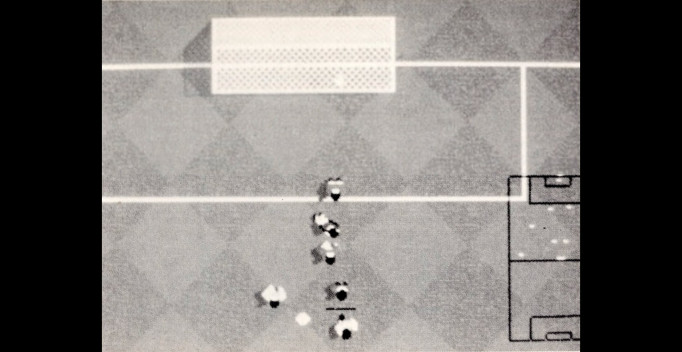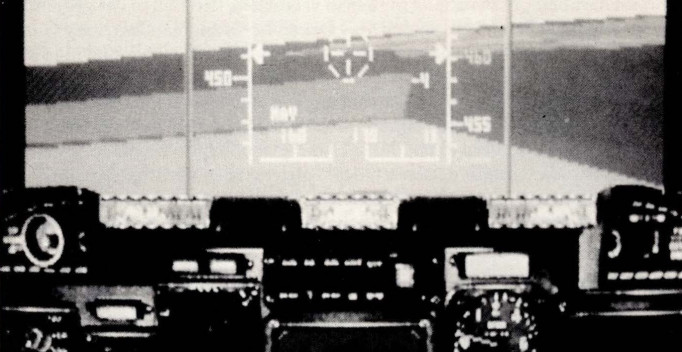Inwiefern verstehen Jugendliche die Inhalte von Computerspielen? Wie nehmen sie die durch diese Spiele vermittelten Botschaften auf? Um diesen Fragen nachzugehen, haben wir eine Umfrage in drei Klassen im Schulhaus Hinterbirch von Bülach (Zürich) durchgeführt.1 Diese empirische Untersuchung versteht sich als Probestudie über diesen Aspekt der Verständlichkeit und Aufnahme, der in der Diskussion über die Wirkung der Computerspiele auf Jugendliche manchmal vergessen wird.
Die Umfrage wurde an zwei Tagen in drei Klassen (Sekundarklasse A und B sowie Realklasse A) durchgeführt. Zwei Schüler, die nie mit Computerspielen gespielt hatten, wurden gebeten, ein anderes Spiel zu beschreiben, das sie gern spielen2. Zum Ausfüllen des Fragebogens gaben wir den Schülern etwa eine Dreiviertelstunde Zeit, wobei fast alle vorher abgegeben haben. Wir standen ihnen zur Verfügung, um Verständnisfragen zu beantworten. Insbesondere in bezug auf die Fragen nach der Beschreibung wurde versucht, durch die Antworten so wenig Einfluß auf den Inhalt zu üben wie möglich. Wir haben sie gebeten, den Namen des beschriebenen Lieblingsspiels anzugeben und es so zu beschreiben, als ob sie es jemandem erklären würden, der es nie gespielt hat.
Die Befragten sind 54 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. In den zwei Sekundarklassen sind die meisten zwischen 14 und 15 Jahre alt, während in der dritten Realklasse die Mehrheit 16 Jahre alt ist. Insgesamt gibt es mehr Mädchen (29) als Knaben (25). Nur 52 Fragebogen gingen in die Auswertung ein, denn zwei Schülerinnen gaben an, nie solche Spiele gespielt zu haben. Die folgenden Zahlen beziehen sich also auf 52 Schülerinnen und Schüler.
Was die Zugangsmöglichkeiten der Schüler zu den Video- und Computerspielen betrifft, stellte sich folgendes heraus: 29 Befragte spielen zu Hause, 18 bei Freunden, 3 Schülerinnen, deren Eltern geschieden sind, geben an, nur bei den Vätern zu spielen, und 2 Schüler haben nur nach dem Informatikkurs in der Schule gespielt. Fast alle finden eine Spielmöglichkeit im nahen sozialen Umfeld. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, daß allen Schülern der Informatikkurs, der ein Semester dauerte, angeboten worden war und daß sich alle freiwillig angemeldet hatten. Vor der Umfrage hatten ihn jedoch noch nicht alle besucht. Nur die Realschüler und Realschülerinnen, die schon in der 3. Klasse waren, und die Knaben der zwei Sekundarklassen hatten die Gelegenheit wahrnehmen können. Die Mädchen der Sekundarschule hingegen sollten ihn erst in der dritten Klasse besuchen dürfen. Diese geschlechtsspezifische Aufteilung der Teilnehmer wurde vom Leiter des Informatikkurses aufgrund der beschränkten Zahl von Computern in der Schule entschieden.3
Die Gruppe mit Videospielen im Haushalt, d.h. diejenigen, die über Videokonsolen (Zusatzgeräte zum Fernsehapparat) oder über Konsolen mit eigenem (kleinem und angebautem) Bildschirm verfügen4, liegen weit hinter denen mit Computern zurück. Alle angegebenen Videospielkonsolen und auch die kleinen game boys wurden von der Firma Nintendo hergestellt, die mit niedrigen Preisen ein Massenpublikum erreicht und hauptsächlich reaktive Videospiele herstellt. Unter den Computern liegt die Marke Amiga vorn, wahrscheinlich weil dieser Computertyp eine komfortable Bedienung und einen umfassenden Anwendungsbereich anbietet. Darüber hinaus ist ein breites Spielangebot für diesen Computer vorhanden.5 8-Bit-Computer wie der Commodore 64, die zu einer „älteren Generation“ von Computern gehören, kommen selten vor.6
Die meisten Schüler mit Spielmöglichkeit zu Hause kopieren oder leihen ihre Software aus, und diese wird nur in seltenen Fällen von ihnen gekauft. Das ist darauf zurückzuführen, daß der Preis der Computerspiele sehr hoch ist und daß die „gecrackten“ Spiele (Spiele, deren Kopierschutz von jemandem durchbrochen wurde) leicht kopiert werden können.7 Diese Bedeutung der Raubkopien und der Tauschtätigkeit unter den Jugendlichen stimmt mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen überein.8 Nach der Meinung von Hans Peter Meier, dem Reallehrer, verschaffen sich einige Eltern auf ihren Reisen und durch ihre Kontakte im Freundeskreis oder im Beruf für ihre Kinder die Raubkopien der modernsten Spiele, und diese Schüler tauschen und verbreiten sie untereinander.9 Darüber hinaus spiegelt sich auch in 6 von 13 Antworten von Schülerinnen die Geschlechterproblematik wider, denn sie weisen darauf hin, daß ihre Brüder die Spiele kopieren oder ausleihen.
Nur 11 Schüler geben an, allein zu spielen. 25 spielen oft in Begleitung, vor allem von Freunden und zum Teil auch von Geschwistern und Eltern, und 12 erklären, daß sie oft beides machen (allein und begleitet spielen). Es zeigt sich also, daß Computerspiele die sozialen Kontakte der Benutzer nicht unbedingt verringern. Umgekehrt gewinnt der Computer, wie andere Produkte, seinen gesellschaftlichen Wert über den sozialen Gebrauch. Dies wird durch die Antworten auf die Frage 6 bestätigt, in denen 18 Befragte behaupten, bei Freunden zu spielen.
Für die meisten Schüler bilden Computerspiele keine Neuheit in ihren Spielgewohnheiten. Aus den Antworten auf die Frage 8 („Wie lange spielst Du schon Computerspiele?“) ergibt sich, daß 23 vor ihrem 12. Altersjahr angefangen haben wollen, die meisten aber nicht vor dem 10. Diese Angaben dürfen jedoch nicht für exakt gehalten werden, weil viele Befragte wahrscheinlich eine nur ungefähr richtige Jahreszahl geschrieben haben. Daß die genaue Antwort auf die Frage schwierig ist, belegen die 10 Fragebögen ohne Antwort (9 davon von Schülerinnen). Einige Schüler nennen statt einer Jahreszahl die Schulstufe, in der sie waren, als sie zu spielen angefangen haben. Dies könnte die Vorgehensweise der meisten gewesen sein, um sich daran zu erinnern.
Die Zahl der Leser von Computerspiel-Zeitschriften ist mit 8 sehr gering. Obwohl diese Zahlen keine klaren Tendenzen erkennen lassen, ist es möglich, daß sich bestimmte Gruppen um ihren Computertyp und die damit verbundenen Zeitschriften bilden. Die gelesenen Zeitschriften sind Amiga Joker, Nintendo Club Magazin und C 64. Die überwiegende Mehrheit liest jedoch keine solchen Zeitschriften. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß alle Schüler, die ihr Lieblingscomputerspiel beschreiben, ziemlich vertraut mit solchen Spielen sind, so daß ihre Möglichkeiten, die Inhalte zu verstehen, nicht von ihrer Spielerfahrung abhängt.
Bei der letzten Frage sollten die Schüler den Namen ihres Lieblingsspiels angeben. Um die von Schülern angegebenen Lieblingsspiele einzuordnen, übernehme ich die von Jürgen Fritz unterschiedenen Spieltypen. Er teilt sie zunächst in zwei grobe Kategorien: Knöpfchen- und Köpfchenspiele. Zu der ersten gehören die Abschießspiele und die „Funny Games“. Das sind „Geschicklichkeitsspiele, bei denen das Schießen auf feindliche Objekte nicht (oder nur selten) vorkommt“, und Sportspiele, die alle zusammen den größten Anteil der verkauften Spiele bilden. Die zweite Kategorie besteht aus den Abenteuerspielen und Simulationen. Darunter sind die Textadventures ihrer sprachlich orientierten Konzeption wegen deutlich seltener als die reaktiven Spiele. Die Simulationen sind ein breiter Bereich, der sehr verschiedene Spiele umfaßt: Fahrzeugsimulationen (Autos, Flugzeuge), Simulationen von Politik- und Wirtschaftsprozessen und von Brett- und Kartenspielen.10
Aus den Ergebnissen der Umfrage geht hervor, daß die Sportspiele mit 15, die „Funny Games“ mit 14 und die verschiedenen Varianten von Simulationen mit 13 den größten Teil der Beschreibungen ausmachen; weit zurück liegen die Abschießspiele mit 4 und die Abenteuerspiele mit 3.
Wenn man schaut, welche Spiele von Knaben und welche von Mädchen am liebsten gespielt werden, stellt man fest, daß die Mehrheit der Spieler von „Funny Games“ Mädchen sind (11 Spielerinnen von insgesamt 14 Spielern), während die Verhältnisse bei den Sportspielen ziemlich gleich sind (8 Mädchen und 7 Knaben). Die Simulationen werden mehr von Knaben (8) als von Mädchen angegeben, ebenso die Abenteuer- und Abschießspiele. Diese Ergebnisse scheinen darauf hinzudeuten, daß schwierige und kriegerische Spiele tendenziell mehr von Knaben als von Mädchen bevorzugt werden.
Mit den letzten Fragen beginnt der qualitativ auszuwertende Teil des Fragebogens: „Welches ist Dein Lieblingsspiel? Was passiert in diesem Spiel? Erzähle bitte alles, woran Du Dich erinnerst, möglichst genau. Du kannst auch auf die Rückseite des Fragebogens schreiben.“ Damit wird versucht, die Schüler zu einer Beschreibung zu motivieren, deren Strukturierung ihnen überlassen bleibt; allem der Name des Spiels sollte einmal erwähnt werden.
Sicher wäre es für die Schüler leichter gewesen, sich mündlich auszudrücken. Meiner mangelnden Schweizerdeutschkenntnisse wegen bevorzugte ich die schriftliche Textproduktion. Die Fähigkeit, sich schriftlich auf Hochdeutsch über ein solches Thema auszudrücken, kann aber bei Deutschschweizer Schülern, die zwischen 14 und 17 Jahre alt sind, ohne weiteres angenommen werden. Schweizerdeutsche Ausdrücke tauchen in den Aufsätzen nur selten auf, und manche werden sogar auch von Schülern selbst als solche erkannt und zwischen Anführungszeichen gesetzt:
Die Gegner sind irgendwelche Individuen, die man „vertrampen“ oder erschießen kann. Es gibt aber auch welche, die man nicht beseitigen kann. Im letzten Raum kommt wie immer ein großes „Viech“.11
Die Schwierigkeit, solche Spiele schriftlich zu beschreiben, ist grundsätzlicherer Natur und hängt nicht mit der Tatsache zusammen, daß sie in Schriftsprache geschrieben wurden. Sie besteht vielmehr darin, eine in den meisten Fällen hauptsächlich durch bewegte Bilder übermittelte Botschaft in Worten darzustellen.12 Deshalb befassen wir uns zunächst mit der Bedeutung, die diese Übertragung von einem Medium in ein anderes in den Beschreibungen einnimmt.
In den Beschreibungen widerspiegeln sich die interaktiven Merkmale des Computerspiels, weil die Spieler die Resultate ihrer Handlungen - anders also als z.B. bei der Beschreibung eines Trickfilmes, den sie gar nicht beeinflussen können - auf dem Bildschirm wahrgenommen und sie dann bei der Umfrage auf dem Papier mit Worten wiedergegeben haben. Aber während des Spiels haben sie nicht nur gelernt, die Logik des Spielsystems induktiv (mit zunehmender Spielerfahrung) zu nutzen, sondern sie müssen zugleich immer neue auf dem Bildschirm erschienene Bilder (elektronische Anzeigen) entschlüsseln. Sie sind gleichzeitig Spieler, Zuschauer und „Bilderleser“ gewesen; sie haben nicht nur gespielt, sondern auch Bilderzeichen dekodiert. Mit Hilfe des Schrift-Codes haben sie schließlich bei der Umfrage ihre Wahrnehmungen wieder verschlüsselt.
Das Bilderlesen darf also nicht übersehen werden13, insofern die Spielbeschreibungen auch Bilderbeschreibungen sind. Um auf die Frage einzugehen, wie sich das Bilderlesen von Computerspielen in den Beschreibungen niederschlägt, gehen wir von einer doppelten Analogie in bezug auf die Bildentkodierung aus: einerseits zwischen Sprache und statischem Bild, andererseits zwischen Sprache und beweglichen Bildern. Und wie normalerweise die Rede von der Fähigkeit des Lesens von Texten ist, sprechen wir von der Lesefähigkeit sowohl der statischen wie der beweglichen Bilder, Fähigkeiten, die u.E. beim Computerspielen zugleich ausgeübt werden, denn die Prozesse vom Lesevorgang statischer Bilder finden auch als Vorstufe bei dem Lesevorgang beweglicher Bilder statt.
Statische Bilder zu lesen bedeutet zum einen das Erkennen denotativer Zeichen, die Dinge be-zeichnen: Man kann z.B. einen Kreis auf dem Bildschirm sehen und als einen Ball erkennen. Zum zweiten bedeutet es das Verstehen von Konnotationen dieser Zeichen, den tieferliegenden Bedeutungen, die je nach kulturellem Kontext anders sein können. Der Ball kann eine Fußballweltmeisterschaft signalisieren. Beide, Denotation und Konnotation, sind wechselseitig bedingt; in der einen schwingt stets die andere mit und umgekehrt. Ein Bild auf dem Bildschirm kann, so wie ein Gemälde, zahlreiche Zeichen enthalten. Auf dem Bild eines Fußballmatchs befinden sich ein Fußballplatz, Fußballspieler, ein Schiedsrichter, ein Publikum usw. In den Beschreibungen wird die Problematik der denotierenden (bezeichnenden) Funktion der Bilder in den Computerspielen am deutlichsten faßbar.
In den Computerspielen können Bilder mit Zeichen erscheinen, bei denen die „Be-zeichnung“ im Vordergrund steht; sie sind fast denotierende Abbildungen von Gegenständen und Figuren, die eher an eine Konstruktionszeichnung (mit fast konnotationslosen Zeichen) als an ein Kunstgemälde (mit konnotationsreichen Zeichen) erinnern.
Die schriftlichen Beschreibungen dieser Zeichen stimmen meistens bei verschiedenen Schülern überein. Regulas Lieblingsspiel ist das Fußballspiel. Sie schreibt darüber: „In dem Spiel muß man versuchen, den Ball in das gegenseitige Gool zu schießen.“ Und in den von Daniel bevorzugten California Games kann man auch Fußball spielen: „Man hat einen kleinen Fußball, und man muß ihn soviel wie möglich jonglieren können.“ Beide verwenden ähnliche Wörter („Ball“, „Fußball“), um auf die Darstellung dieses Objektes hinzuweisen.
Es gibt aber Bilder, deren summarische Zeichen auf einen Gegenstand nur in einer vagen Form verweisen, ihn aber nicht deutlich be-zeichnen. In diesen Fällen spielt die intuitive Leseart des Spielers eine wichtige Rolle. Diese Leseart läßt sich an den unterschiedlichen Substantiven erkennen, die in den Beschreibungen für dieselben Bildzeichen benutzt werden. Nadine beschreibt einen Teil des Spiels Arkanoid folgendermaßen:
Mein Lieblingsspiel ist sehr einfach. Es gibt einen Ball, den man fortspicken muß. Und um ihn wieder zu fangen, hat man eine bewegliche „Plattform“. Das Ziel des Spiels ist es, möglichst viele „Länder“ zu durchqueren. Man kann auch Punkte erzielen, indem man den Ball in [!] Baustein spickt; der Ball wird reflektiert, und der Baustein fällt herunter. In diesem Baustein erscheint dann ein Buchstabe.
Viviane hat dieselben Zeichen ein bißchen anders verstanden:
Mein Lieblingsspiel ist Arkanoid! Es hat viele verschiedene Päckchen aneinandergereiht. Man muß versuchen, diese Päckchen mit einem Ball zu vernichten. Viele Pakete fallen dann herunter (es gibt rote, blaue, grüne, braune, graue und pinkige Pakete), die man auffangen muß mit einem Stäbchen.
Was für Nadine Bausteine sind, sind Pakete für Viviane; was von Nadine als „Plattform“ aufgefaßt wird, nennt Viviane „Stäbchen“. Offensichtlich handelt es sich um Bildzeichen, die nur umrißhaft angedeutet sind, bei denen der bildliche Kontext nicht zur eindeutigen Bestimmung beiträgt. Sie fordern daher die Vorstellungskraft des spielenden Zuschauers.
Dabei spielen die Absicht und die Fähigkeit des Designers eine wichtige Rolle, denn anders als bei der Skizze eines Künstlers handelt es sich bei vielen (vor allem alten) Computerspielen um vereinfachte und abstrahierte Bildzeichen. Es darf nicht vergessen werden, daß die Graphik der Computerspiele seit etwa 1960 eine wichtige Entwicklung durchgemacht hat (von der einfachen Tischtennissimulation Pong, die 1972 auf den Markt kam, bis zu dem heutigen fernsehähnlichen Tennisspiel wurden mehrere Grenzen durchbrochen14) und daß die Wirkungen dieser Entwicklungen auf einige heute noch vorhandene Formen bemerkbar sind. Die Beherrschung des neuen Mediums als bildliches Ausdrucksmittel hat länger als zwanzig Jahre gedauert und ist wahrscheinlich nicht abgeschlossen.
Patricia M. Greenfield hat die These aufgestellt, daß die Computerspiele die dynamischen visuellen Elemente des Fernsehens enthalten. Sie ist außerdem der Meinung, die von den Kindern beim Fernsehen erworbenen visuellen Fähigkeiten seien für viele Computerspiele nötig und werden mit ihnen weiterentwickelt. Bewegliche Bilder zu lesen, wird also vor allem beim Fernsehen gelernt.15
Die Fernsehsprache besteht aus visuellen Elementen, die auch Symbole sind, weil sie auf etwas in der Realität verweisen. Der Zuschauer muß sie also entschlüsseln, um ihre Bedeutung zu verstehen. Ein Schnitt z.B. ist ein solches Symbol, das Information über Raum oder Zeit vermittelt: Es kann einen Szenenwechsel bedeuten oder zwei Blickpunkte derselben Szene.
Bei vielen Computerspielen müssen die spielenden Zuschauer (die Spieler) denselben Grundcode wie beim Fernsehen verwenden, um Informationen aus verschiedenen Perspektiven zu koordinieren und sie räumlich zu integrieren, um den auf dem Bildschirm dargestellten dreidimensionalen Raum wahrzunehmen. Oder wie bei einem Zoom (kontinuierliche Veränderung der Brennweite) haben sie den Zusammenhang zwischen dem Ganzen und einem Ausschnitt der Aufnahme zu erkennen.
Dieses räumliche Vorstellungsvermögen kommt insbesondere bei den Beschreibungen moderner Versionen von Sportspielen und Flugsimulationen zum Ausdruck. Christophs Lieblingsspiel ist eine solche Simulation und heißt F29:
Das ganze Flugzeug kann man noch mit den speziellen (beim Amiga) F-Tasten [...] von allen Seiten von außen betrachten; auch weiter und näher kann man das Bild von außen heranholen. Die feindlichen Flugzeuge sieht man nur auf dem Radar, denn sie fliegen an einem vorbei wie ein Blitz, darum hat man Wärme-Lenkraketen, um sie abzuschießen.
In einem Teil der ausführlichen Beschreibung, die Käthi von California. Summer Games macht, beschäftigt sie sich mit dem Problem der Wahrnehmung einer Figur, die sich außerhalb der Aufnahme befindet:
Frisbee: Dieses Spiel mag ich nicht so besonders. Am Anfang sieht man so einen Mann, der eine Frisbee-Scheibe in den Händen hält. Die Frau, die die Scheibe dann später in Empfang nimmt, sieht man noch nicht. Man weiß nur ungefähr, wo sie steht, denn oben am Bildschirm ist ein kleiner Lageplan eingezeichnet. Wenn der Mann die Scheibe wirft, muß man, als Frau, die Scheibe fangen können, denn sonst gibt es keine Punkte.
Die Beherrschung des Codes ist sowohl bei statischen wie bei beweglichen Bildern gar nicht selbstverständlich. Man kann die Auffassung vertreten, daß dieses Lesen (und nicht nur das Spielen als Tätigkeit, die die Hand-Auge-Koordination erfordert) auf den Bilderleser ermüdend wirkt und nicht unbedingt einfach ist. Trotz der Hilfe einer Karte oder eines Lageplans (die zusätzliche optische Hinweise liefern, aber an sich Bilder von einem hohen Abstraktionsgrad sind) werden die Lage und der Raum nicht immer klar. Pascals Beschreibung läßt diese Schwierigkeiten zum Teil erkennen:
Mein Lieblingsspiel heißt „F-18 Interceptor“. Da geht es darum, mit einer F-18 den Luftraum über San Francisco von feindlichen Flugzeugen zu befreien. Das Schwierigste an diesem Spiel ist das Landen und das Überprüfen der Höhenangaben und des Radars. Doch trotz allem ist es immer wieder lustig anzuschauen, wenn eine Rakete das Ziel verfehlt und dummerweise mal das Wahrzeichen in Schutt und Asche legt. Die Raffinessen, die dieses Game hat, sind für einen Laien wie mich erstaunlich. Da sind z.B. die verschiedenen Außenansichten des Flugzeugs, die man auf Knopfdruck erblicken kann.
Die oben erwähnte Tendenz der Programmierer von Computerspielen, den Grundcode der Fernsehsprache zunehmend zu übernehmen, ist gar nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, daß einerseits beide Medien (Fernsehen und Computer) ihre Botschaft über einen Bildschirm vermitteln und andererseits sowohl die Designer wie die Spieler in einer durch das Fernsehen geprägten Kommunikationswelt leben. Auch wenn mit dem interaktiven Charakter der Spiele Unterschiede zur der Fernsehsprache Zusammenhängen wie z.B. die übliche Kürze der Szenenfolgen, die ständig abgebrochen und wieder angefangen werden müssen, erreichen manche Spiele eine große Ähnlichkeit mit dem Muster. In solchen Fällen ist die Rede von „Wirklichkeit“ in den Beschreibungen. Sandro bewertet Silent Service II (eine U-Boot-Simulation) fast wie für eine Computerspiel-Zeitschrift:
Das ganze Spiel ist dank einer guten Grafik und diversen Operationen sehr wirklichkeitsnah. [...] Das Spiel selbst gefällt mir, weil es sehr wahrheitsgetreu ist, und weil alles sehr real abläuft.
Nicht allein um „Bilder-Lesen“, sondern auch um das Lesen im seinem üblichen Sinn geht es bei den in ihrer Konzeption bildlich orientierten Computerspielen. Die Schrift ist nicht völlig abwesend. Sie tritt zunächst im Vorspann als Titel auf, spielt weiter eine Rolle während des Spiels mindestens bei der Rückmeldung über die erreichte Punktzahl und beendet das Spiel mit dem bekannten „Game over“. In den Beschreibungen tritt sie oft in diesen drei Funktionen auf.
Die Belohnung durch Punkte wird fast in jeder Beschreibung erwähnt, insbesondere bei Sportspielen nimmt sie eine wichtige Stellung ein. Pascal schreibt über World Games:
Es gibt dann je nach Leistung Punkte, die von jeder Disziplin zusammengezählt werden. Am Schluß, das heißt wenn jede Sportart vollendet ist, rechnet der Computer zusammen, wer am meisten Punkte hat.
Der Wiederbeginn wird auch in manchen Fällen durch die Schrift angekündigt, wie z. B. bei Mah Jong, das Nadja gern spielt:
Der Stein muß auf seiner Längsseite frei sein. Das geht nun soweit, bis keine Steine mehr zu sehen sind. Oft geht es aber schon nicht mehr, wenn noch eine gewisse Anzahl von Steinen zu sehen ist. Dann erscheint der Ausdruck: „No more move“ auf dem Bildschirm. Nun kann man es wieder von vorne versuchen.
Die Beendigung des Spiels wird auch durch die Buchstaben offenkundig. Silvia beschreibt das Ende von Bubble Bobble folgendermaßen:
Wenn man alle Monster gefangen und aufgelöst hat, geht es ins nächste Labyrinth.
Dort geschieht dasselbe, jedoch etwas schneller und schwieriger. Wenn man eine gewisse Zeit im selben Labyrinth bleibt, kommt ein Geist. Wenn der den Drachen berührt, ist es „Game over“. Man hat sonst drei Leben.
Das Phänomen solcher Code-Vermischungen ist eine Gemeinsamkeit der beweglichen Bilder mit den traditionellen statischen Bildern, deren Ursache in der Unvollkommenheit beider visuellen Kommunikationssysteme liegt. Die lebendigen Bilder brauchen zur Erklärung die Schrift. Aber wird diese Erklärung immer begriffen? Je bessere Englischkenntnisse der Schüler hat, desto schwierigere Texte kann er bei den oft in dieser Sprache geschriebenen Spielen verstehen und auch wiedergeben. Die in den Computerspielen relativ häufig vorkommenden Erläuterungen auf Japanisch lassen hingegen keine Spur in den Beschreibungen zurück. Verdrängen die Schüler die Tatsache, daß sie sie nicht verstehen?
Die Code-Vermischungen können andere Formen annehmen wie etwa in den Fällen, in denen alleinstehende Buchstaben einen Teil des Bildes und damit des Spieles bilden. Silvia gibt ein solches Beispiel an:
Es hat auch eine Menge anderer Sachen im Labyrinth, z.B. Tortenstücke, Lampen, Diamanten, Kreuze usw. Diese Sache geben alle Punkte. Es hat auch Buchstaben drin, die man holen kann. Auf der linken Randseite ist eine Tabelle aufgezeichnet, in der die Buchstaben eingetragen werden.
Schließlich sei darauf hingewiesen, daß man in vielen Spielen auch schreiben darf, aber meistens nur ein Wort oder einige Buchstaben. Nicht einmal der ganze Name, sondern nur die Initialen der besten Spieler werden gespeichert. Komplizierte Spiele bieten auch die Möglichkeit, ein Paßwort zu schreiben, z.B. Mega Man II, wie Christian erzählt:
Bei diesem Spiel muß man verschiedene Levels besuchen. Wenn man alle besucht hat, kommt man zu einem Schlußparcours und danach zum Schlußmonster, das bei diesem Spiel „Dr. W“ heißt.
Da dieses Spiel sehr lange dauert und auch nicht einfach ist, kann man sich nach jedem Level ein Paßwort merken, damit man nicht immer von neuem beginnen muß. Wie das Schlußmonster aussieht, weiß ich nicht, denn ich bin noch nicht so weit gekommen.
Obwohl für die befragten Schüler im allgemeinen die Computerspiele eine normale Freizeitbeschäftigung bilden, stellt man bei der Inhaltsanalyse der Beschreibungen fest, auf welche Schwierigkeiten sie bei der Verständigung der in diesen Spielen verwendeten bildlichen Sprache stoßen. Die verbreitetsten Spiele bestehen aus Bildern, die gelesen und verstanden werden sollen. Ihre Botschaft wird jedoch nicht in allen Fällen begriffen: Gewisse dargestellte Objekte müssen durch eine intuitive Leseart interpretiert werden; verschiedene Perspektiven müssen koordiniert werden, um den dargestellten dreidimensionalen Raum wahrzunehmen. Obwohl die beim Fernsehen erworbenen visuellen Fähigkeiten sich dabei als nützlich erweisen, wirken die Spiele wegen der erforderten Konzentration ermüdend. Hinzu kommt das Lesen von Schrift, die in diesen Computerspielen nicht völlig abwesend ist und die normalerweise für die Schüler verständlich ist. Es handelt sich meistens um Wörter, Sätze oder Texte auf Englisch.
Die Möglichkeiten der Inhaltsanalyse erschöpfen sich nicht mit den in der vorliegenden Arbeit behandelten Bereichen. Man könnte anhand dieser Beschreibungen weitere Themen behandeln, wie z.B. die Fähigkeit der Schüler, die Grundstruktur der in den Computerspielen enthaltenen Geschichten zu erkennen; oder den Identifikationsgrad vom Spieler mit der Hauptfigur dieser Handlungen, die sie oft „Männchen“ nennen, und den Eindruck von Teilnähme am Geschehen in Simulationen, bei denen es keine Identifikationsfigur auf dem Bildschirm gibt, in der der Spieler sich erkennen kann: „Man sitzt in einem Flugzeug.“