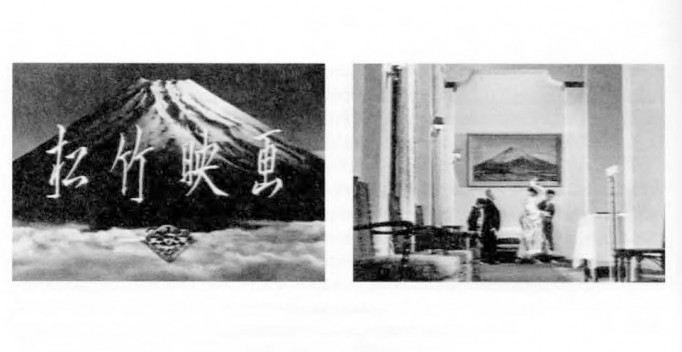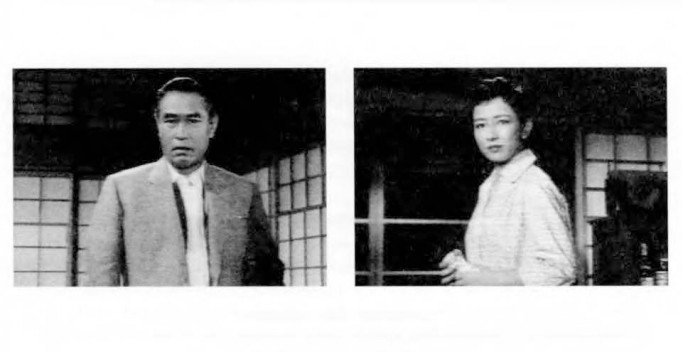Wir gehen ins Kino und sehen uns einen Film an, und manchmal geht in dem Film eine Person wiederum ins Kino, Theater oder Kabarett - und wir bekommen zu sehen, was sie dort sieht, meist etwas Lohnendes punkto Schauwert, zum Beispiel eine spektakuläre Tanzszene, was weiter keine Probleme macht. Tut sich aber in der fiktionalen Welt des Films - wofür die Filmwissenschaft den Begriff Diegese benützt - eine weitere fiktionale Welt oder Diegese auf, die eines Films im Film oder eines Schauspiels im Film, kann es brisant werden. Im kommerziellen Spielfilm sorgfältig und niedrig dosiert, äußert sich die Brisanz einer Zweitdiegese in uns als ein durchaus angenehmes vorübergehendes Schwindelgefühl, ein kleines Extra-Amüsement. Wir realisieren dabei wohl nicht, daß dieser Schwindel der gerade noch erträgliche Anfang eines freien Falls aus dem vertrauten diegetischen Weltbild ist, der, kaum begonnen, sofort wieder gestoppt wurde, mit Hilfe von speziellen Maßnahmen. Ihre Aufgabe ist es, die Zweitdiegese in die Hauptdiegese zu integrieren und sie unmißverständlich als Einlage zu kennzeichnen.
Käme aber ein imaginärer Passant ohne Vorwissen im richtigen falschen Moment in eine Vorstellung von Der einzige Sohn (Hitori musuko, Ozu Yasujiro, Japan 1936), so hätte er eine Zeitlang weder Anlaß noch Möglichkeit festzustellen, daß hier nicht der romantische deutsche Musikfilm Leise flehen meine Lieder (Willi Forst, 1933) läuft. Er sähe eine Blondine im Puszta-Kostüm durchs reife Kornfeld streifen und kokett einem jungen Mann enteilen, der ihr nachruft und ihr ein Schultertuch nachträgt; sie bleibt stehen; die beiden beginnen, beklommen vor Verliebtheit, ein Gespräch; sie spielt mit dem Tuch, dieses fällt ins Korn, was bedeutet: Sie küssen sich. Es ist der letzte und (mit sechs Einstellungen und einer Laufzeit von über einer Minute) längste der fünf Ausschnitte aus Leise flehen meine Lieder, die während der Schauszene in Der einzige Sohn zu sehen sind. Ozu hat keinerlei Maßnahmen ergriffen, um die Einschübe als Diegese zweiter Ordnung zu kennzeichnen und ihre fiktionale und visuelle Kraft zu entschärfen; die einmontierten Filmbilder sind weder verkleinert noch beschnitten, noch in einen Rahmen oder schräg oder hinter eine Publikumssilhouette gestellt. Von allen mir bekannten Schauszenen in Filmen nach 1920 enthalten die von Ozu die waghalsigsten Einschübe, die unintegriertesten. Nicht nur wurden sie in Der einzige Sohn, typographisch gesprochen, nicht kursiv gestellt, es gibt auch weder Doppelpunkt noch Anführungszeichen. Ohne Vorwarnung und ohne visuelle Markierung des Übergangs folgen sich auf der Leinwand, direkt aneinandergeschnitten, Einstellungen aus zwei verschiedenen Filmen.
„(Halbnah) Teekessel, an der Wand ein umgekehrt aufgeklebtes Amulettbild. Schnitt (Halbnah) Sugiko näht. Schnitt (Halbnah) Otsunes unausgepackte Reisetasche, an den Wänden das Amulettbild und weitere auf geklebte Bilder, am besten sichtbar das einer blonden Frau. Schnitt (Groß) Eine blonde Frau (Martha Eggerth) singt zu Musik:... es mir immer wieder, sag, daß du mich liebst!“
Wäre da nicht die kategoriale Kontinuität von Blondinenbild und Blondine im Bild, müßte das Schlimmste angenommen werden - falsch geklebte oder vertauschte Filmrollen. Das also nicht, aber die Irritation ist dennoch massiv und hält an, bis einige Sekunden später Otsune und ihr Sohn in den Kinosesseln gezeigt werden.
Ganz und gar unvermittelt setzt die Schauszene in Ozus Stummfilm Eine Frau aus Tokyo (Tokyo no onna, 1933) mit einem ersten Einschub ein, indem acht Minuten nach Filmanfang plötzlich englische Vorspanntitel mit Namen von Darstellern, Regisseuren und Szenaristen auf der Leinwand erscheinen - es handelt sich um drei Titelkarten des Paramount-Episodenfilms If I Had a Million... (1932). Nach einem kurzen Schnitt ins Kinopublikum, wo Egawa Ureo und Tanaka Kinuyo sitzen, folgt Ernst Lubitschs dreiminütige Episode The Clerk von Beginn bis kurz vor Schluß, mit einem Unterbruch von etwa vierzig Sekunden (Tanaka sucht ihr Kinoprogramm, und Egawa gibt ihr seins). Und während in Der einzige Sohn am Schluß des letzten Einschubs eine Ab- und Aufblende den Wechsel aus der Zweitdiegese zurück in die Hauptdiegese markiert, führt uns hier Ozu auf dem Rückweg in die Hauptdiegese schwungvoll in die Irre: Lubitschs Serie aneinandergeschnittener Bürotüren trägt uns mit Charles Laughton die Hierarchiestufen aufwärts, trägt uns in einem unwiderstehlichen Rhythmus von Tür zu Tür und von Einstellung zu Einstellung und unaufhaltsam noch eine weiter, eine zu weit - statt im Büro des Firmenbosses von Laughton sind wir in der Wohnung des Polizisten Kinoshita gelandet; an der Wand hängen Handschuhe und Koppel.
Zu Ozus Schauszenen später mehr.
Aus Wut oder Witz gibt jemand im Zürcher Telefonbuch „Anthropophag“ als Beruf an. Auch mich bringt die Frage nach meiner Arbeit oft in Verlegenheit und provoziert Umschreibungen („Spezialitätenköchin“). Neulich verstand ein telefonisches Gegenüber „Filmwüsseschafteri“ falsch als „Fiinwüsseschafteri“, in Analogie zu Feinmechaniker; das hat mir gut gefallen. Wir untersuchen fein und formulieren möglichst präzis. Doch wozu die Befunde und ihre Mitteilung taugen, ist nicht ganz klar, und es wird auch nicht besprochen. Die Welt und somit auch alle Filme und filmischen Phänomene sollen benannt und beschrieben sein? Wissenschaftliche Selbstlegitimation? Sozialkritische Analyse? Zufall, Privatvergnügen, Arbeitsbeschaffung? Eine Bastion kultureller Werte angesichts der totalisierten Ökonomie? Kampf für oder gegen etwas? Je fließender der wissenschaftliche Diskurs, desto unbenannter und uneinsichtiger unsere Motive und Ziele.
Wissenschaftlichkeit und wahre Liebe machen beide detailsichtig und detailsüchtig. Es heißt, das Auge der Liebe sehe verklärt, aber das stimmt nicht; das liebende Auge nimmt jedes Körperdetail am Geliebten wahr und verzeichnet alles genauestens im Herzen. Liebe beobachtet, forscht, interpretiert. Außerdem leidet sie unter ähnlichem Begründungsnotstand wie die Wissenschaftlichkeit und kassiert die gleichen Vorwürfe („blind, unproduktiv, zwecklos“). Bei beiden darf nebenbei mit Selbsterkenntnis gerechnet werden, was nicht zu verachten ist. Ich liebe seit langem Lubitsch, Ophüls und Ozu, und während der Vorarbeiten zu einem wissenschaftlichen Text über Schauszenen bei Ozu wurde mir klar, daß diese drei so verschiedenen Regisseure etwas gemeinsam haben, ein in mehreren Epochen und filmischen Gesamtwerken auftauchendes Syndrom.
Pro memoria: Ernst Lubitsch lebte von 1892 bis 1947 und ging 1923, damals Deutschlands Spitzenregisseur, nach Hollywood. Seine Spezialität waren Komödien von sublimer Unverfrorenheit. Max Ophüls lebte von 1902 bis 1958 und drehte nach zehn Jahren Theaterarbeit ab 1931 Filme, als Mehrfachemigrant in verschiedenen Ländern. Seine Spezialität waren extravagant inszenierte Liebesmelodramen. Ozu Yasujiro lebte von 1903 bis 1963 und arbeitete von 1927 bis zu seinem Tod als Hausregisseur der Produktionsfirma Shochiku, und seine Spezialität war jene der Shochiku, der realistische Familienbeziehungsfilm. Zu Lebzeiten hatte Lubitsch internationalen Erfolg, Ozu nationalen und Ophüls punktuellen. Als Stilmerkmal von Lubitsch wird gern der witzige Schnitt genannt, von Ophüls die ausschweifenden Kamerabewegungen, von Ozu die ungewöhnlich tief positionierte starre Kamera. Lubitsch gilt als unterhaltend, Ophüls als schön, Ozu als asketisch.
Alle drei arbeiteten in der Genrefilmkonfektion, und die Filme, an die ich hier denke, stellen einerseits absolute Spitzenexemplare des jeweiligen Genres dar und andererseits noch etwas anderes, noch viel mehr. Von der geschlossenen Form des Genres her sind sie einfach, von einem offenen Rand her vertrackt. Das alles gehört bereits zum Syndrom. Hier soll von zweien seiner auffälligsten Elemente die Rede sein, von Schauszenen und Selbstreferenzen. (Zwei weitere wären Ungebündeltheit und Theatralität.) Sie gehören eng zusammen, da Schauszenen mehr oder weniger direkt selbstreferentiell auf die Schaukunst Film verweisen.
Alle drei, Lubitsch, Ophüls und Ozu, behandeln die filmische Diegese nicht als sakrosankt und arbeiten nicht ausschließlich darauf hin, ihr eine möglichst solide Konsistenz zu verleihen. Ab und zu nützen sie im Gegenteil aus, was die Fragilität der Diegese an Potential bietet. Sie leisten es sich, der Fiktion auch einmal die Luft abzudrehen und die Diegese aufs Spiel zu setzen; das tun sie zielsicher, mit lustvoller Professionalität. Und weil dem, der da hat, gegeben wird, gewinnen sie auf diese Weise zu ihren vielen Vorzügen weitere Attraktionen und höhere Komplexität hinzu: mein verführerisches Syndrom.
Man kann sich eine filmische Diegese als hohle Kugel vorstellen, welche die fiktionale Welt enthält, und sich weiter von einer ordentlichen normalen Diegese vorstellen, daß sie im Zentrum eines Dreiecks fixiert ist, in gleichen Abständen von den drei Eckpunkten Publikum (Rezeption), Regisseur (Produktion) und Realität (Referenz). Bei dem Dreieck handelt es sich um ein Bermudadreieck; es macht die Verbindungslinien zu den Eckpunkten und diese selbst unsichtbar. Im klassischen Illusionskino sind diese Verbindungen bekanntlich tabu und werden - ein Pakt zwischen Produzenten und Rezipienten - möglichst verschleiert (Produktion) und ignoriert (Rezeption), um eine ungestörte Illusion aufzubauen. In der Mitte des Bermudadreiecks der Fiktion also schwebt die illusorische Seifenblase der Diegese und wird nicht angefaßt, damit sie nicht platzt.
Für meine Zwecke ist es dienlich, die Kugel auf eine Fläche und das Dreieck auf eine Linie zu reduzieren, indem ich den Eckpunkt „Referenz“ weglasse. Nach dieser Vorstellung steht die Normaldiegese als eine unbewegliche, opake, fugenlose Wand zwischen Produktion und Publikum. Wiederum sind die Abstände fest und die Verbindungslinien tabu. Zum traditionellen willing Suspension of disbelief gehört, daß das vor der Wand sitzende Publikum auf die Wand starrt und nicht auf den realen Ursprung des Films hinter der Wand.
Selbstreferenz und Schauszenen bringen dieses Dispositiv durcheinander, ein Effekt, der gewöhnlich durch weiter unten beschriebene Verfahren gemildert oder verhindert wird. Selbstreferenzen machen ein Loch in die diegetische Wand, durch welches das Publikum plötzlich direkt auf den realen Ursprung des Films sieht; Schauszenen machen die Diegese spürbar mobil und austauschbar wie ein Bühnenprospekt und thematisieren Produktion und Rezeption von Darbietungen. Bei unabgedämpften Selbstreferenzen und Schauszenen herrschen für einen kurzen Moment ungewohnt klare, direkte Verhältnisse. „Ich zeige etwas“, sagt die Produktion und ist in diesem Moment nicht unsichtbar hinter der diegetischen Wand versteckt. „Ich schaue zu“, sagt die Rezeption, eventuell verdutzt, und die beiden stehen Auge in Auge. An sich sind solche Verhältnisse aus älteren Formen des Kinos, aus bestimmten Filmgenres und aus anderen Schaukünsten gut bekannt. (Wer nur Kino kennt, hat schon deshalb Mühe mit seiner ersten Oper, weil dort die Beziehung zwischen Produktion und Rezeption variabler und zeitweise direkt ist.)
Schauszenen und Selbstreferenz im Kino der zehner Jahre
Damit ein Einschub als solcher wirkt, muß er in einen längeren Spielfilm mit einer funktionstüchtigen Diegese eingebaut sein. Jedoch kamen die Schauszenen nicht nachträglich in die Spielfilme hinein, sondern waren lange vor diesen da; Tonbilder (welche den Sänger, das Bühnengeschehen oder eine filmische Umsetzung des Textes einer Arie zeigten, die während der Filmprojektion ab Schallplatte gespielt wurde), Artistenfilme und Tanzszenen bilden prominente Genres der Kurzfilmzeit vor 1910. Aus solchen Darbietungen und anderen Attraktionsnummern - Landschaftspanoramen, Städtebildern, dramatischen und komischen Szenen, Aktuellem und Sehenswertem aus aller Welt - setzten sich die damaligen, varietéartig gemischten Kurzfilmprogramme zusammen.
Es ist sinnvoll, den Übergang vom Kurzfilm zum Langspielfilm nach 1910 mit zwei Modellen zu beschreiben, die zugleich zwei Bauprinzipien langer Filme abgeben. Nach Modell I ist ein gemischtes Kurzfilmprogramm zu einem längeren Film zusammengewachsen; als Bauprinzip waltet die abwechslungsreiche, diskontinuierliche Reihung abgeschlossener Szenen von großem Schauwert, wobei die Diegese wenig Konsistenz erlangt und offen und ungebündelt bleibt. Nach Modell II hat sich ein dramatischer Einakter zu einem Langspielfilm ausgewachsen - die kurzen Spielfilme der Frühzeit wirken oft wie komprimiert und durchlaufen rasant gleichsam die Handlung eines vollständigen Dramas. Zu längeren Filmen gedehnt, behalten sie das ursprüngliche Bauprinzip bei; es ist die kontinuierliche Verkettung von Kausalzusammenhängen zu einer geschlossenen Diegese. Dieses Modell paßt besser auf den handlungszentrierten Hollywoodfilm und Modell I auf die europäischen Produktionen vor 1920, zu deren üppiger, raffinierter Visualität Schauszenen und Attraktionsnummern viel beitragen: Feste, Tanzdarbietungen, Opernausschnitte in der Nachfolge der Tonbilder, grandiose Landschaften, Schiffshavarien und Feuersbrünste. Auch in neuerer Zeit bevorzugten einige Produktionen (der indische Film, der jiddische Film, der Kung-Fu-Film) aufgrund kultureller Vorgaben das Reihungsprinzip.
In der Theorie wertete die normative Filmgeschichtsschreibung der dreißiger Jahre die diskontinuierliche Reihung ab („theatralisch, unmodern“) und die Kontinuität auf („filmisch, modern“), in der Praxis bewährte sich das geschmähte Modell I jedoch vorzüglich; es liegt auch einigen erfolgreichen Hollywoodgenres zugrunde (dem Historienspektakel, dem Musical) und ist ganz einfach unentbehrlich. Was wäre das für ein Kinoleben ohne Hear My Song oder Strictly Ballroom? Es fällt auf, wie gern das neue Medium in der Zeit vor 1920 sich selbst zum Thema nahm; das verraten schon Filmtitel wie Die Filmprimadonna, Una tragedia al cinematógrafo, Kulisy ekrana (Hinter der Leinwand), Wenn die Filmkleberin gebummelt hat und Meine Frau, die Filmschauspielerin. Oft handelt es sich um Komödien, und nicht umsonst, denn Selbstreferenz hat etwas Frappantes und Flagrantes, das der Gattung Komödie entspricht: Das Spiel der Fiktion als Spiel zu behandeln ist ein humoristisches Grundverfahren, weshalb das Genre der selbstreferentiellen Filmkomödie immer wieder auflebt (Thomas Graals bästa film, Hellzapoppin’, La nuit américaine, Stardust Memories). Andere frühe Formen von Selbstreferenz wurden aber nach 1920 tunlichst vermieden. Zum Beispiel brachten manche Produktionsfirmen ihr Logo - den Pathé-Hahn, das Eclair-Blitzbündel, das AB-Monogramm der American Biograph - nicht nur auf Titelkarten, sondern auch in den Filmkulissen an; diese Referenz auf die Urheberschaft sollte Raubkopien verhindern und Reklame machen (wie heute die ständig sichtbaren Logos der Fernsehstationen). Zweitens wurde bis zu einem nicht genau festlegbaren Zeitpunkt um 1918 die reale Welt nicht total aus der fiktionalen verbannt, sondern darin am Rande toleriert. Realitäts- und Selbstreferenz fallen zusammen, wenn in Spielfilmen unbeteiligte Passanten kurz stehenbleiben oder sich neugierig umdrehen, weil da Filmaufnahmen stattfinden; sie schauen an der Spielhandlung vorbei in die Kamera, und ihre Blicke treffen uns. Ähnlich verhalten sich oft auch Statisten: Bei einer Massenszene in Die Börsenkönigin (Edmund Edel und Asta Nielsen, Deutschland 1916) strömen offensichtlich echte Minenarbeiter wegen einer fiktionalen Grubenexplosion auf die Kamera zu und teilen sich vor ihr; einige kurven etwas herum, unentschieden, ob sie rechts oder links an der Kamera vorbeilaufen sollen, deren Präsenz wie ein Keil in die Bildtiefe ragt bis an jenen Punkt, an dem die Arbeiter auf sie zu reagieren beginnen, ihr entgegenblicken. Spielfilme konnten außer Schauszenen also auch selbstreferentiell wirkende Realitätseinschlüsse enthalten. Direkte Reaktionen auf die Kamera finden sich in den zehner Jahren relativ häufig in allen Filmgattungen. In nichtfiktionalen Filmen der Zeit sieht man zum Beispiel Bauern, die vor der Kamera lachend einige unwirksame Mähbewegungen vormachen: Sie tun nur so als ob. Von all den Varianten, so zu tun als ob, welche die Filmkamera provoziert, ist jene, so zu tun, als sei die Kamera nicht da und als sei dies kein Film, ein Standard geworden; die anderen leuchten aber ebenso ein, und man lernt sie schätzen. Auf Zuschauer ohne Erfahrung mit dieser Art Kino wirken sie jedoch, wie wenn in einem neuen Film ein Mikrophon ins Bild hängt: ein naiver Lapsus nach den heutigen Regeln des Handwerks, störend und heiter.
Integrierung
Die beiden eingangs beschriebenen filmischen Schauszenen von Ozu wirken nicht direkt falsch, aber sehr frappant. Ihre Wirkung war ursprünglich wohl noch stärker, denn die Einschübe stammen aus Filmen, welche fast gleichzeitig in Japan zu sehen waren wie die Ozu-Filme, in denen Stücke von ihnen auftauchen und diegetische Unruhe stiften. Ich werde hier die Unruhe nicht theoretisch analysieren, so interessant das wäre, sondern stelle nur fest, daß Ozu - für die dreißiger Jahre - zu weit geht. Vor allem dauern die Einschübe zu lang, indem wir nicht in jeder zweiten Einstellung wieder in der Hauptdiegese Fuß fassen können (probates Entschärfungsverfahren); mit jedem Schnitt sinken wir tiefer in die Zweitdiegese ein, und nach dem dritten oder vierten Schnitt schlägt sie endgültig über uns zusammen oder, anders gesagt, schwimmen wir schon willig mit ihr mit, die Hauptdiegese aus den Augen und aus dem Sinn. Wir geraten in den nächsten Film, weil nichts uns daran hindert, und schon zerbricht die Diegese, das ganze Dispositiv mit Rezeption, Wand und Produktion löst sich auf, das Publikum verliert kurz und heftig die Orientierung. Ausgeschlossen, daß Ozu nicht genau das wollte. Hier wollte er einen kleinen Diegese- Schocker, weshalb er die Schauszene weder diegetisch motiviert noch formal integriert, noch dramaturgisch funktionalisiert hat.
Diegetische Motivierung, formale Integrierung und dramaturgische Funktionalisierung erlauben es, ohne Risiko für Konsistenz und Kontinuität, der Hauptdiegese Schaunummern beizumischen; nach 1920 wurden diese Verfahren so gut wie obligatorisch. Im Film- oder Bühnenmilieu angesiedelte Filme motivieren Einschübe von Darbietungen, und darin treten dieselben Personen auf wie in der Hauptdiegese - wir sehen den Protagonisten bei ihrer Arbeit zu. Personalunion und durchgehender Handlungsfaden verweben Schauszenen und Diegese zu einer unauflöslichen Einheit. Das Genre ist ebenso attraktiv wie beliebt (einige Klassiker: Der Blaue Engel, Les enfants du paradis, To Be or Not To Be, The Red Shoes, Sunset Boulevard). Auch aus Japan sind zahlreiche derartige Filme bekannt, von den Anfängen bis Yamada Yojis Kinoparadies (Kinema no tenchi, 1986). Ozu drehte zweimal Schwimmpflanzen (Ukigusa monogatari, 1934, und Ukigusa, 1959), die Geschichte einer Wanderschauspielertruppe, und tatsächlich, wir bekommen mehrere Minuten Provinztheater von 1934 bzw. 1959 vorgeführt. Das Genreprogramm stammt aus älteren Schaukünsten: Die Titelheldin der Oper Tosca ist Sängerin, der Titelheld des Theaterstücks Kean ein Schauspieler.
Die direkte Selbstreferenz des Filmmilieufilms wird durch eine Verschiebung auf andere Bühnenkünste indirekt, sozusagen metaphorisch, und entsprechend schwächer. Ophüls mit seinem progressiven Theaterhintergrund war dauernd zu Selbstreferenz und Schauszenen aufgelegt und debütierte mit einem Filmmilieufilm (Die verliebte Firma, 1932), doch sind in seinem Werk filmische Schauszenen selten - Irrtum Vorbehalten, einmal ein Kinobesuch (Sans lendemain, 1939) und einmal Heimkino (Caught, 1948/49) -, um so häufiger dafür die verkappte Selbstreferenz in Form von Bänkelsängern, Nachtklubrevuen, Photographen, Laterna-magica-Projektionen oder Zirkusnummern. Auch bei Ozu ist die Liste nichtfilmischer Schauszenen lang und vielfältig, stellvertretend für alle sei das No-Spiel in Spätfrühling (Banshun, 1949) erwähnt und, eine weitergehende Verschiebung (von einer fiktionalen Schaukunst zu einer nichtfiktionalen Darbietung), das Velorennen in Reis mit Grüntee (Ochazuke no aji,1952).
In Heimkino-Schauszenen sind filmische Einschübe diegetisch motiviert - wie im Bühnenkünstlerfilm treten Charaktere der Hauptdiegese in der Darbietung auf, zum Beispiel der Vater in Ozus Ich wurde geboren, aber ... (Umaretewa mita keredo ..., 1932). Einschübe aller Art sind formal integriert, wenn während der Darbietung der diegetische Zuschauerraum sichtbar bleibt und einen Teil der Leinwand beansprucht, so daß das Gezeigte gerahmt, verkleinert, schräg gestellt, angeschnitten oder teilweise von Zuschauern überdeckt wird. Solche formalen Integrierungsverfahren verwendet Ozu in Ich wurde geboren, aber... und Ophüls in Caught und Sans lendemain für filmische Schauszenen.
Drittens bietet sich die dramaturgische oder thematische Einbindung von Schauszenen an, bekannt und beliebt spätestens seit Hamlets play within the play. Was in der Zweitdiegese geschieht, hat einen Bezug zur Handlung der Hauptdiegese und manchmal auch direkte Auswirkungen. Zweitdiegesen antizipieren, spiegeln, ironisieren, warnen, klären auf. In Sans lendemain belehrt das Leinwandgeschehen Georges eines Schlechteren: keine Hochzeit, die Braut soeben abgereist. Aus der Heimkinovorführung in Ich wurde geboren, aber... erfahren die beiden Knaben, daß ihr Vater nicht der Größte ist, sondern sich auf Verlangen seines Vorgesetzten vor dessen Kamera lächerlich macht. In Monte Carlo (Ernst Lubitsch, 1930) verfolgt die Komtesse mit steigender Spannung eine Aufführung der Oper Monsieur Beaucaire, und was eröffnet ihr der Bühnengesang über die Identität ihres süßen, aus Standesgründen verschmähten Friseurs Rudi? „The barber is a prince!“
Ozus isolierte Einschübe
Diegetische, formale und dramaturgische Einbindungsverfahren homogenisieren Hauptdiegese und Schauszene, wobei 85 Jahre Praxis lehren, daß eindeutig die formale Isolierung oder Integrierung darüber entscheidet, ob eine Schauszene die diegetische Einheit gefährdet oder nicht. Wie Isolierung zu erzielen ist, führt besonders schön und deutlich Nicholas Ray vor, in The Party Girl (1958), mit einer flamboyanten Tanznummer, welche die an sich gegebene diegetische Motivation (es tanzt die weibliche Hauptfigur) komplett wegfegt. Also: Man nehme eine Darbietung, filme sie unabhängig von diegetischen Zuschauerblickpunkten, filme sie allenfalls frontal, mache sie leinwandfüllend und tilge somit den diegetischen Raum, folge mit Kamerabewegungen, Einstellungsgrößen und Schnitt ihrer Eigendynamik und mache die Sequenzen nicht zu kurz - mit 40 Sekunden kommt man aus, mit 90 kann man schwelgen. Ray geht auf Nummer Sicher, er hebt die Einschübe auch farblich und musikalisch heraus und läßt die Tänzerin direkt in die Kamera blicken. Ozu, stets ökonomisch, zeigt, daß es genügt, Einschübe a) leinwandfüllend zu machen und b) über mehrere Schnitte hinweg fortzusetzen, um sie ganz und gar aus dem diegetischen Rahmen fallen zu lassen bzw. letzteren zu sprengen. Weshalb aber gezielt herbeiführen, was alle aus guten Gründen und mit viel Aufwand vermeiden?
Einfach gesagt, in diesen Momenten zeigen Ray und Ozu Film als Film, was sich eindeutig nur an nichtfilmischen Darbietungen (Tanz, Velorennen, Theater) nachweisen läßt. Beginnen filmische Einschübe nach kurzer Zeit als diegetische Ereignisse zu wirken, so nehmen wir umgekehrt nichtfilmische Einschübe nach und nach deutlich als Ausschnitte aus selbständigen Filmen wahr; statt als diegetische Ereignisse wirken sie eklatant als filmische Aufzeichnungen, und zwar um so augenfälliger, je geringer der fiktionale Gehalt. Und das entspricht natürlich genau den Tatsachen, denn es handelt sich um Aufzeichnungen, nicht um Ereignisse. Die Diegese aber ist das Gegenteil einer Tatsache, sie ist ein Effekt, der in jedem Moment eines Spielfilms erzeugt und auf einem gewissen Pegel gehalten werden muß. In formal isolierten Einschüben setzt er rasch aus und mit ihm das diegetische Dispositiv; wir wechseln in ein anderes, gleich angelegtes: an der Wand nun ein Dokumentarfilm (eines Velorennens, einer Theateraufführung) oder ein anderer Spielfilm (von Forst, von Lubitsch). „Ich habe gefilmt und zeige einen Film“, sagt die Produktion und zwingt uns Rezipienten zur aufrichtigen Antwort: „Wir sehen einen Film.“
Die amerikanischen Neoformalisten (Bordwell, Branigan, Thompson) halten Ozus Schauszenen für unfunktional, weil „irrelevant to the plot“, und sie haben zwei Optionen, um das Problem loszuwerden. Man kann a) eine Integrierung unterstellen, wo keine ist, wie das Bordwell mit dem No-Spiel in Spätfrühling tut oder b) die Nichtfunktionalität als typisch für Ozus Arbeitsweise bezeichnen und auf einer höheren Ebene integrieren: Ozu spielt eben mit den filmischen Parametern, wovon einer Funktionalität ist, und im Spiel mit Funktionalität ist Nichtfunktionalität funktional.
An sich richtig, hingegen stimmt die Prämisse nicht: Die isolierten Einschübe in Ozus Filmen sind höchst funktional, sogar multifunktional. Erstens funktionieren sie, wie dargelegt, als starke, direkte Selbstreferenz auf Film, und zwar die nichtfilmischen so gut wie die filmischen. Zweitens gehören sie, sieht man genauer hin, zu großangelegten thematischen Strukturen, und drittens treten in ihrer unmittelbaren Umgebung zentrale Konflikte an die Oberfläche, was sie zu markanten Stationen der dramatischen Entwicklung macht. (Zur Illustration dieser zwei Funktionen müßten thematische und dramatische Anlagen ganzer Filme skizziert werden, was hier zu weit führen würde.) Viertens sehe ich einen Zusammenhang zwischen dem Reichtum an Schauszenen in Ozus Gesamtwerk und einem auffälligen Mangel: Es gibt keine Metadiegese - das heißt, keine Visualisierung innerer Bilder aus der Subjektivität von Filmprotagonisten, also keine Träume, Phantasien, Erinnerungen. Man kann sogar argumentieren, es gebe kein Blickpunktverfahren bei Ozu (Noriko und die chinesische Vase in Spätfrühling sind mehrfach analysiert worden, zwecks Nachweis oder Widerlegung von Blickpunktbeziehungen). Nie wird uns Einblick ins Innere der Filmfiguren gewährt, sie bleiben so opak wie reale Menschen, und wie diese wissen sie oft nicht recht Bescheid über sich und das Leben. Wir sehen sie dasitzen - ein Standardbild bei Ozu -, innerlich bewegt und absorbiert von Gedanken und Gefühlen. Wir sehen dann manchmal in der unmittelbaren Umgebung derart selbstversunkener Protagonisten eine Schauszene mit langen Einschüben, und da letztere wenig integriert sind, können wir sie nicht recht verwerten; sie dauern, wir verweilen (und werden allenfalls so unaufmerksam wie Noriko, die ihrem Groll nachhängt, statt dem No-Spiel zu folgen). In ihrer unbestimmten vibrierenden Dramatik nehmen die Schauszenen die Schwingungen des inneren Zustandes der Protagonisten wie ein Resonanzraum auf. Sie unterbrechen die Hauptdiegese und eröffnen einen separaten Ereignisraum (der zwar als Teil des diegetischen Raums eingeführt wird, aber wegen der formalen Isolierung zeitweise unverankert wirkt); und sie ermessen mit der Beschleunigung eines Rennens, der Intensität eines No-Stücks eine hochgespannte Emotionalität. Sie fungieren als Platzhalter - zeitlich, räumlich und dynamisch - für emotionale Vorgänge und Zustände, die Ozu prinzipiell nicht ins Bild setzt. Statt die Diegese bruchlos und konsistent zu gestalten, bricht er sie durch isolierte Einschübe zwar rabiat auf, wahrt aber andererseits eine Bruchlosigkeit seiner Wahl: die Oberfläche und das gegenwärtig Sichtbare zu zeigen und nichts sonst. Niemals bekommen wir das unsichtbare Innerseelische zu sehen, und niemals das unsichtbar Gewordene, die Vergangenheit - in Ozus Gesamtwerk gibt es meines Wissens keine einzige Rückblende. Bei aller expliziten Referenz der Schauszenen auf die Künstlichkeit und Konstruiertheit der filmischen Fiktion bedient sich Ozu ausgerechnet derselben Schauszenen, um zwei Gesetze der Wirklichkeit eisern zu wahren: die Materialität alles Sichtbaren und die Unumkehrbarkeit der Zeit.
An dieser Stelle verzichte ich auf einen historisch-ästhetischen Exkurs über die enge Verwandtschaft zwischen Darbietungseinschüben und metadiegetischen Einschüben - es gäbe zuviel Schönes und Seltsames zu beschreiben - und beschränke mich auf die strukturelle Übereinstimmung. Wie metadiegetische Einschübe unterbrechen in Ozus Schauszenen die formal isolierten Einschübe die Kontinuität der Hauptdiegese. Wie jene direkt, haben diese indirekt mit dem inneren Erleben zu tun. Anstelle der visuellen Umsetzung der Innenschau in der Metadiegese bietet Ozu uns in einer diegetischen Darbietung eine abstrakte Entsprechung. Er geht davon aus, daß unsere emotionale Teilnahme im Sichtbaren Dimensionen des Unsichtbaren wahrnimmt. Mit seinem Vertrauen auf ein sehendes und fühlendes Publikum gewinnt er die Freiheit, Film, Theater oder Sportereignis in ihrem eigenen Schauwert zu zeigen und sehen zu lassen, ohne daß sie darauf reduziert würden, Ersatz oder Veräußerlichung innerer Vorgänge zu sein. Er gewinnt außerdem für seine Filmprotagonisten eine diffuse Komplexität der Gefühle, die weit realitätsnäher ist als die filmübliche Grobskala. Drittens fühlt man sich als Publikum mit einem Ozu-Film in freier Luft und in guter, angenehmer Gesellschaft, dank dem wenig zudringlichen Umgang mit Zuschaueremotionen, Filmprotagonisten und Realitäten.
Ausgehend von den Schauszenen erkenne ich einige für Ozu zentrale Felder oder duster - darunter „abgeschlossene Szene“, „emotionaler Resonanzraum“, „Selbstreferenz“ und „Theatralität“ -, die im Œuvre in einer Vielfalt von Varianten, Kombinationen und Stärkegraden Vorkommen. Szenen sind sowohl abgeschlossen als auch unterschwellig theatralisch, wenn Ozu in einen leeren Raum Protagonisten auftreten und am Schluß der Szene wie von einer Bühne abtreten läßt, und wir sehen den Raum wiederum leer. Die zentrale Szene in Reis mit Grüntee - Herr und Frau Satake bereiten nachts in der Küche die Titelmahlzeit zu - ist so gestaltet und zusätzlich an Anfang und Ende von mehrfachem Türöffnen und -schließen, Lichtmachen und -löschen markant und symmetrisch eingerahmt; die frontale Aufnahme ohne Kamerabewegung verstärkt die präsentierend-theatralische Wirkung; dazu kommen - für Ozu - extrem lange Einstellungen. (Auch darin, daß die Szene nahezu stumm ist, erinnert sie an das frühe Kino.) Die Grundform von „emotionaler Resonanzraum“ ist eine Sequenz, in welcher Einstellungen von nachdenklichen Protagonisten mit Einstellungen aus ihrer näheren Umgebung alternieren: Noriko und die chinesische Vase in Spätfrühling, Taeko und die Eisenbahnbrücke in Reis mit Grüntee.
Neben den Schauszenen fällt eine weitere Form von abgeschlossenen Szenen auf, die „irrelevant to the plot“ erscheinen und sich in der Zuschauerwahrnehmung aus der Hauptdiegese lösen: In mehreren Nachkriegsfilmen setzt Ozu Klassenzusammenkünfte und Kriegsveteranentreffen an, die formal sehr ähnlich wie Schauszenen gestaltet sind. Diese von keiner dramaturgischen Notwendigkeit motivierten Anlässe sind wie in Wirklichkeit der Erinnerung an eine gemeinsame Vergangenheit gewidmet, und es werden Lieder aus jener Zeit gesungen. Die an sich diegetischen Lieder wirken wie lange isolierte Darbietungseinschübe. Einstige Schulkameradinnen summen Titelsongs alter Filme, ehemalige Studienkollegen stimmen „Gaudeamus igitur“ an (beides in Reis mit Grüntee); während Ryu Chishu eine lange Heldenballade aus militaristischen Tagen vorträgt, übermannt versonnene Melancholie eine Runde von Kriegsveteranen (Sommerblüten, 1958). Wie die Schauszenen funktionieren die Hörszenen als „emotionaler Resonanzraum“ für das diegetische und das reale Publikum. Ozu läßt das Vergangene nicht sehen, doch er gewinnt die Dimension der Vergangenheit und den Innenraum der Erinnerung durch die enorme Erinnerungsmacht von Liedern und Musikstücken. Auf das japanische Publikum muß seinerzeit der Eindruck dieser Melodien aus der Vergangenheit sehr stark gewesen sein; sie sind mit einer kollektiven Erinnerung aufgeladen, die ein Publikum aus späteren Generationen oder anderen Kulturen nicht teilt, aber erahnen kann. Ich bringe die Liedeinschübe in direkten Zusammenhang mit dem Verzicht auf metadiegetische Rückblenden, überlege weiter, daß bei Ozu die Einhaltung der Zeitordnung mit der ungebundenen Bewegungsfreiheit im Raum, die er sich leistet, korrelieren könnte, und erinnere mich, daß Urban Gad, Regisseur der zehner Jahre, in Der Film: seine Mittel - seine Ziele (1920) für eine strikte Einhaltung der Zeitordnung plädiert.
Ich bin abgeschweift, um an einen bestimmten Punkt zu kommen. Isolierte Einschübe von Darbietungen, Gesangsnummern, abgeschlossene Szenen - plötzlich zeichnet sich in Ozus Filmen der fünfziger Jahre deutlich die Struktur eines Films der zehner Jahre ab, ein zusammengewachsenes Kurzfilmprogramm, eine Perlenkette von nichtfiktionalen Kurzfilmen und Schaunummern: „Velorennen“ - „Teezeremonie“ - „Flughafen. Ein Flugzeugstart“ - „Eine Mahlzeit wird zubereitet“ - „Baseballmatch“ - „Ein Ausflug ans Meer“ - „Im Pachinkosalon“ - „Die Ballade von Kusunoki Masashige“ (Tonbild) - „Zugfahrt über die Große Brücke“ - „Die Sehenswürdigkeiten von Kyoto“. Und da hängt in Sommerblüten in einem Hotelkorridor als gerahmtes Bild an der Wand das Fujiyama-Logo der Shochiku: mit einem schönen Gruß dem Pathé-Hahn.
Selbstreferenz in der Umgebung von Schauszenen
Schauszenen wirken selbstreferentiell, indem sie Darbietung und Zuschauen thematisieren, sie scheinen aber auch ein besonders günstiger Ort für verbale Formen von Selbstreferenz zu sein. Aus den reichen Vorkommen bei Ozu, Lubitsch und Ophüls je ein Beispiel:
1. Während Martha Eggert in Leise flehen meine Lieder in Ozus Der einzige Sohn laut Soprano singt, sagt der Sohn zu seiner Mutter: „Weißt du, das ist nun eben Tonfilm.“ („Nee, kore wa tôkî to itteru.“) Nun war Der einzige Sohn Ozus erster Tonfilm, vermutlich weltweit einer der letzten ersten Tonfilme. Ozu blieb so lange wie möglich beim Stummfilm, er wechselte erst 1936 zum Ton, von den führenden Regisseuren Japans mit weitem Abstand der letzte. Man hat wohl mit steigender Spannung darauf gewartet: Wann endlich kommt der erste Ozu-Tonfilm, wie wird er sein? Es singt und sagt: „Das ist nun eben Tonfilm.“ Die Mutter schläft gleich ein, wenig beeindruckt.
2. In der musikalischen Komödie Monte Carlo bringt Lubitsch schließlich Zweitdiegese und Hauptdiegese in eine Engführung; der Bühnengesang nimmt der Komtesse die Worte „Highness, can you forgive me?“ aus dem Mund, und das Bühnengeschehen spielt ihr vor, daß sie Rudis Liebe endgültig verscherzt habe, während dieser sich neben ihr ostentativ zum Weggehen bereitmacht. Ihre Augen füllen sich mit Tränen, er schaut sie freundlich an und sagt: „I don’t like that ending. I like happy endings!“ Schnitt, und das Paar singt im fahrenden Zug: „Beyond the blue horizon waits a beautiful day...“ Es soll Lubitschs Lieblingslied gewesen sein. Jemand sagt: „I like happy endings“ und liefert unverzüglich eins. Zu Beginn der Schauszene qualifiziert außerdem der Verlobte der Komtesse die Oper Monsieur Beaucaire als „silly story, only possible with music“, zugleich eine selbstironische Aussage über das Musical Monte Carlo und seinesgleichen.
3. In Ophüls’ tragisch endendem Liebesmelodram Sans lendemain (1939) sitzen Evelyne und Georges im Kino (in einer zehn Jahre zurückgreifenden Rückblende: Der von Musikanten begleitete Stummfilm markiert den Zeitabstand). Sie meint, den Blick auf die Leinwand geheftet: „Das ist ja schrecklich traurig!“, er dagegen hoffnungsfroh: „Das endet bestimmt mit einer Hochzeit!“ Genau diese zwiespältige Spannung auf eine glückliche Vereinigung oder ein schrecklich trauriges Ende hin kennzeichnet das Melodram Sans lendemain und seinesgleichen. Der für mich nicht identifizierbare, vielleicht dänische Gauklerfilm verweist außerdem auf Ophüls’ Leidenschaft für Zirkus und Schaustellerei und seine Zirkusfilme Die verkaufte Braut (1932) und Lola Montes (1955).
Als Ereignisse überraschen gute Schauszenen und Selbstreferenzen, sie erstaunen, sie machen bestürzend glücklich wie ein erstklassiger Witz oder eine köstliche Speise. Zum Beispiel dies: Im Schnee stehen zehn rauchende Kochherde, und auf jedem sitzt ein Räuber (Die Bergkatze, Ernst Lubitsch, 1921).
Bei Ozu, Lubitsch und Ophüls nehme ich Schauszenen und Selbstreferenzen als greifbares pars pro toto für eine Art, Filme zu machen, welche sich durch ein besonderes Verhältnis zum Publikum auszeichnet: das Herzstück des Syndroms. Sie geben ihm zu verstehen, daß es für sie unentbehrlich ist. Dieses Angebot an das Publikum - das zugleich die Existenz des Publikums anerkennt und seiner Sehlust und Sehfähigkeit vertraut - erfährt man am unmißverständlichsten dort, wo es nicht von einem einzelnen Filmautor abhängt, sondern das selbstverständliche Dispositiv einer ganzen Produktion ist: im Attraktionskino vor 1910 und dem so sehenswerten europäischen Kino der zehner Jahre.
Als reelle Konfektionäre erfüllen uns Lubitsch, Ophüls und Ozu die Genrewünsche der dreißiger bis fünfziger Jahre aufs vorzüglichste, liefern beschwingte Heiterkeit (Trouble in Paradise, Lubitsch), bittersüßen Gefühlssog (Letter from an Unknown Woman, Ophüls), warmherzige Lebenserkenntnis (Tokyo monogatari, Ozu). Aber ihnen reicht das nicht, sie haben Talent und Ambitionen für mehr, und sie lieben ihre Arbeit über alles. Die Norm des Üblichen und die Ökonomie des Notwendigen weit hinter sich lassend, haben sie ihre Verfahren vermehrt, angereichert, verfeinert. Und weil sie ihre Arbeit und ihr Arbeitsmaterial sehr lieben und ausgezeichnet beherrschen, dazu selbstsicher und möglicherweise auch mit Recht stolz auf das eigene Können sind, setzen sie sich über die Geheimniskrämerei mit dem diegetischen Effekt hinweg und führen vor, was man damit alles anstellen kann. Sie fordern das Publikum auf, die diegetische Wand von nah, von fern oder zur Abwechslung von hinten anzuschauen. Sie frönen der für Spezialisten typischen Lust an der reizvollen Vielfalt der Spielarten und an extremen oder seltenen Varianten, auch an extrem einfachen. Sie halten mich nicht für dumm und blind, sondern trauen mir zu, schlau und aufmerksam zu sein. Denn sie haben ihre Filme besonders gut, besonders schön gemacht, sie haben Ostereier versteckt und Überraschungen vorbereitet, und während der Projektion stehen sie neben der diegetischen Wand und schauen mir gespannt zu: Gefällt es ihr? Hat sie den Dreh begriffen? Hat es ihr Spaß gemacht? Ist sie zweimal um die Ecke mitgekommen? Nein? Um so besser, das macht ihr beim nächsten Mal Freude.
Sie haben nicht bloß reichhaltige Filme gemacht, in denen ein paar interessante Besonderheiten wie Schauszenen und Selbstreferenzen Vorkommen, ihre Filme sind immer auch ihre Auftritte, ihre artistische Darbietung als Jongleure mit Diegesen und Ellipsen, als Kapellmeister des Dienstbotenorchesters, als fliegende Trapezkünstler der Nebenschauplätze und Zwischenstücke. (Ozu ist der mit den Korridoren, Ophüls der mit den Treppen, Lubitsch der mit den Türen.) Wie gewisse italienische Kellner oder japanische Köche erheben sie die Kundschaft pauschal zum idealen Mitspieler, zum sachverständigen, anspruchsvollen Kollegen, für den sich der Aufwand lohnt. Und das tut dem Publikum wahnsinnig gut.
Es gibt Standardproduktionen, die das Publikum kalkuliert abspeisen - einer Industrie, die konsumierbare Qualität bei rechtem Preis-Leistungs-Verhältnis liefert, ist nichts vorzuwerfen. Es gibt Regisseure, die das Publikum verachten und nur als Bewunderungslieferanten benutzen; sie haben Moral, Amoral, Gefühlstiefe und sowieso Kunst für sich gepachtet und machen Filme in erster Linie, um sich ihrer eigenen Bedeutung zu versichern. Spüre ich im Kino den Mundgeruch eines derartigen Künstlersubjekts, entferne ich mich schonungsvoll und desinteressiere mich für das Schaffen des Betreffenden. Es ist keineswegs eine Frage der Qualität, sondern eine des Menschenbildes und des Beziehungsangebots. Was soll ich mich gleichzeitig ignorieren und mißbrauchen lassen und die Leute dafür noch loben müssen, wenn wunderschöne, kluge Filme sich um mich bemühen, mit Höflichkeit, mit Charme, mit freundschaftlicher Anerkennung?
Ozu, Ophüls und Lubitsch haben Stil, dazu gehören Manien und Obsessionen, an sich beklemmende Tendenzen, denen sie durch Inkonsequenz entkommen. Fehlerlose Konsequenz, makellose Schönheit schüchtert ein; eine Schwäche in einem gesamthaft genialen Kontext wirkt befreiend, gewinnend, und schließlich wird man sie lieben als eine Stärke: Ozus manchmal hanebüchene Musikeinsätze, deplaziert und plärrend, und dieser tranige Pierre Richard-Willm bei Ophüls in den Hauptrollen von Yosbiwara und Wertber - nur That Uncertain Feeling von Lubitsch finde ich nach wie vor trostlos.
Generalisierte Inkonsequenz heißt: nicht zur Einheitlichkeit gebündelt. Im Hollywoodfilm und ähnlich bündigen Produktionen (Teilen des Weimarer Kinos) wird alles, was gut und teuer ist, für einen eindeutigen Effekt investiert, und heraus kommt das Hineingesteckte: heldische Helden, böse Böse, gefährliche Gefahr, erlösende Befreiung. Wenn Truffaut Lubitsch zuschreibt, „wie alle Genies vom Widerspruchsgeist besessen zu sein“, so gilt das ebensogut für Ozu und Ophüls, die Tonfall und Inhalt ihrer Narrationen systematisch inkongruent halten und den Ernst des Lebens (Ozu) und die Katastrophe der Liebe (Ophüls) gegenläufig begleiten lassen von unpassenden Nebengeräuschen, Zwischenfällen und Witzen, darunter auch Selbstreferenzen, die ja fast immer einen komischen Effekt machen. Weil sie ihre Filme so bauen, daß diese zwei oder mehr einander widersprechende Formen von Kino - sagen wir: Illusionskino und Schaustellerei - zugleich erfüllen, bauen sie Mobiles. Aus deren Beweglichkeit entstehen unablässig neue, schwebende Konfigurationen, weshalb man sie beliebig viele Male anschauen kann, sie wiederholen sich nicht. Es sind keine schwerverständlichen Filme, nur verstehen wir sehend mehr, als wir sagen können. Auf dieser Basis arbeiten Ozu, Ophüls und Lubitsch.
Alle drei wurden als unpolitisch abqualifiziert, als ahistorische Eskapisten. Dem muß widersprochen werden. Sie haben nicht von den sozialen Realitäten abgesehen, sondern im Gegenteil sehr scharfe Aussagen über Geld, Macht, soziale Konventionen, Klassenhierarchien und das Geschlechterverhältnis gemacht. Und nur bei Ozu, in Der Geschmack der Makrele (Samma no aji, 1962), habe ich je diesen einfachen Satz gehört: „Zum Glück hat Japan den Krieg verloren.“
Was sie uns in Schauszenen demonstrieren - daß die Diegese keine Substanz, vielmehr ein frei modulierbarer Effekt ist -, kann auf Wissenschaftlichkeit übertragen werden. Auch diese ist ein Effekt. Aus der Kombination von Elementen entstehen imaginäre Wahrnehmungsbilder. Ausgeprägt theoretisch veranlagte Menschen erstellen geschlossene Systeme in einer gewissen Distanz von den Phänomenen, ausgeprägt komparatistisch veranlagte wollen mit konkreten Nuancen arbeiten und darum ihnen nahebleiben. Man sollte sich frei fühlen, diverse Kombinationen auszuprobieren. Außerdem könnte eine Wissenschaftlichkeit, die sich unter anderem auch als eine Form von Schaustellerei erkennt, ein entsprechend zugewandtes Verhältnis mit ihrem Publikum pflegen.
Im vorliegenden Text war die Kombination teils frei, teils historisch vorgegeben. Lubitsch produzierte das Kino der zehner Jahre mit und rettete dessen unbefangene Direktheit in spätere Zeiten. Ozu rezipierte Lubitsch intensiv und prägend, außerdem ist bei ihm mit den japanischen Erzähl- und Schaukunsttraditionen zu rechnen, deren variable, reflektierte Beziehungen zwischen Produktion und Rezeption sich zum Vergleich mit dem europäischen Avantgardetheater nach Pirandello anbietet, von dem dann drittens Ophüls herkommt, welcher sich wiederum lebhaft an das frühe Kino erinnert.