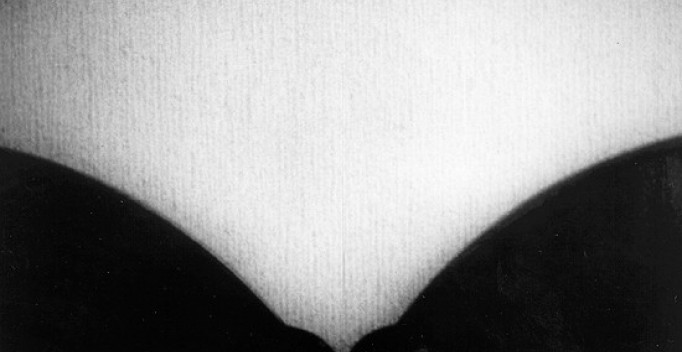Der Film Die Urszene (1981) richtet sich nicht auf «die Koitusbeobachtung im Kindesalter» aus, die im Gefolge Freuds diesen Namen trägt, sondern, wohl zur Enttäuschung der am Anfang durch einen Vorhang spähenden Frau, auf deren Fehlen. In langsamen, tastenden, schweifenden Bewegungen werden mögliche Schauplätze vorgeführt: leere Betten, zerwühlt oder sorgfältig zurechtgemacht; eine Reihe von Schlafzimmern, die sich ebenso gut als Demonstration sozialer Umstände oder privater Gepflogenheiten wie als Kulisse für das ausgesparte Geschehen verstehen lassen. Suggestiv wie die Falten, Musterungen, Materialien der im Zentrum der Aufmerksamkeit stehenden Textilien ist auch die Musik, die zur Idee dieser aller Erwartung zuwiderlaufenden Inszenierung den Anstoss gab. Im Song Rock-and-Roll Waltz, rückhaltlos vulgär vorgebracht von Kay Starr, nimmt das beobachtende Kind nicht Anstoss an der (hier in der Variante des Tanzes vorgeführten) Urszene an sich. Vielmehr stört es sich daran, dass sich die Eltern nicht – Rock, Roll! – nach der gegebenen Musik, sondern unbekümmert über sie hinweg im Takt eines unhörbaren Walzers bewegen. Wort- und tonlos geht es dann, nicht durchwegs im Walzertakt, um eine Botschaft, die – bei aller Lust an der pikanten Auswahl einschlägiger Interieurs –, vor allem die je wieder andere Dynamik zur Geltung bringt, die die uns vorenthaltene Urszene in die ständig sich verändernde Konstellation der Bilder einbringt.
Ständig gespannt auf das hin, was fehlt, sehen wir beim Zuschauen nicht nur, was es zu sehen gibt, sondern wir schauen uns auch selber beim Zuschauen zu; derart gelenkt von der unerwartet vom Vordergründigen aufs Diffuse und aus dem Halbdunkel wieder zur scharf umrissenen Einzelheit zurückkehrenden Kamera, dass wir, abgelenkt von unseren gradlinigen Gewohnheiten, uns um einen Begriff von Raum und Zeit erst wieder bemühen müssen. Es oszillieren jetzt die Dinge, die unseren Blick auf sich lenken, zwischen dem, was sich zeigt, und dem, was sich in ihnen verbirgt. So verwandeln sich die hölzernen Kurven, die als Ausschnitt aus dem Porträt eines Doppelbetts zu nehmen wären, in das ausladende Dekolleté einer üppig und doch schemenhaft aus dem Nichts auftauchenden Frau, die auch gleich wieder verschwindet, und ein Wandbild am Kopfende eines germanistischen Doppelbetts – Goethe in der Campagna – scheint sich für die Dauer eines Versehens auf eine wahrhaftige Landschaft hin zu öffnen. Die Urszene, als Schwarzweissfilm aufgenommen, ist, smaragdgrün eingefärbt, aus der Schroffheit ihrer Helldunkel-Kontraste zurückgenommen in eine Beleuchtung, die den Katalog mehr oder weniger bürgerlicher Wohnkultur in die submarine Domäne unartikuliert traumhafter Vorgänge versetzt. Traumhaftes bricht immer wieder in Brinckmanns Arbeiten ein; in Bildern, die – obwohl präzis umrissen – zwischen dieser und jener Bedeutung in der Schwebe bleiben; die nicht schön sind, nicht hässlich, nicht böse, nicht gut. In The West Village Meat Market (1979) zum Beispiel steht in diesem Zwielicht das rasch durch die Gosse fliessende, im zufälligen Licht einer Spiegelung rot eingefärbte Wasser, das uns im Bann des Kontexts wider besseres Wissen zu Blut wird. Oder, in Dress Rehearsal (1980), die Frau, die in bald vergnügter, bald nachdenklicher Parodie in der Männerrolle die Frau und in der ohnehin prekären Unschuld der sich schliesslich statt mit einem Schleier mit einem Spitzenhöschen schmückenden Braut das Flittchen zum Vorschein bringt. Es entfaltet sich in solchen doppeldeutigen Bildern das Unentschiedene, dem sie als dessen erste Ausgeburt entwachsen sind. Je nach Blickwinkel, je nach Licht zeigen sie dieses oder jenes Gesicht. Man darf sie nicht beim Wort nehmen. Hat je eine Urszene gehalten, was sie versprochen hat? Wir sollen nicht gleich verstehen wollen, was wir sehen. Lassen wir die Dinge Dinge sein. Was wir lassen, kommt auf uns zu.
Im Unentschiedenen gibt es keine Himmelsrichtungen und keinen Kompass, der sie anzeigt. Es gibt denn auch in Brinckmanns Filmen keinen Sinn im Sinn der Ausrichtung auf ein Ziel hin, sondern nur einen, der sich allmählich in Assoziation und Ahnung herausbildet. Wenn es in einer solchen Anlage auch nicht den sprichwörtlichen roten Faden geben kann, der uns über die Stimmigkeit des Ablaufs beruhigt, spielt doch in der Gliederung der Bildfolgen die in fast allen Filmen von Noll Brinckmann dicht gestreute Farbe Rot eine wichtige Rolle. Besonders markant in The West Village Meat Market, wo Schwarzweisspassagen sich mit anderen ablösen, die – wie es sich in einer gezielten Auswahl der Objekte natürlicherweise ergab – als einzige Farbe rot sehen lassen: nicht nur das bereits erwähnte trügerisch rote Wasser, sondern auch das rote Fleisch im Kontrast zum weissen Fett, die blutverschmierten weissen Schürzen der Arbeiter, eine rote Tür und, als gälte es, einzelne Strophen voneinander abzusetzen, in angemessen unregelmässigen Abständen immer wieder ein Stück von dem Rot, mit dem jeweils das Ende eines Films eingefärbt wird. Rote Zehennägel, Blumen, Ohrringe, Lippen; die roten Borsten eines ausgedienten Besens, chinesische Kalligraphie, Krawatten, ein roter Krimi in einer offenen Schublade oder die kostbare Seide, die in Der Fater (1986) den Amateuraufnahmen des Vaters sozusagen als Kontrastfolie dient: Überall setzt die Farbe in ihrer Signalfunktion Akzente, die Erinnerungen anfachen und Emotionen ins Spiel bringen. Ein lebhafter visueller Reiz leitet hinüber in Bereiche, in denen zum Zug kommt, was man nicht sieht; ein unmittelbar wirksamer Rhythmus, der die gegebene Ordnung der Dinge zersetzt und neue, überraschende Zusammenhänge stiftet. Unartikuliert und unübersetzbar stellt sich in solchen Wendungen immer wieder blitzartig die Erkenntnis ein: Ja, so ists. So muss es sein. Und dann auch sogleich wieder die Frage: Aber was denn? Die Einsicht lässt sich nicht fassen. Nur erfahren; in einem neuen Blick durch die alten Augen. Was wir eben noch als selbstverständlich hingenommen haben, nehmen wir jetzt wahr als das, was es hier, in dieser Konstellation, in dieser Beleuchtung einmalig ist.
Die meisten Dinge, die uns Brinckmann in Form von Gebrauchsgegenständen, Kleidungsstücken, Accessoires und so fort präsentiert, sind nicht rot. Sind auch nicht bemerkenswert. Sind oft nicht einmal Dinge, sondern Undinge: Schrott, Sperrmüll, überquellende Abfalleimer. Plastik in allen Farben, in Fetzen; wie es am Boden liegt, im Wind flattert. Wie es sich in Falten wirft, wie es das Licht fängt, wie es – durchsichtig und nicht – einen Hintergrund aus beweglichen Schattenbildern durchblicken lässt: Brinckmann liebt das Plastik, liebt den Abfall, die Undinge mit einer Intensität, als liesse sich aus ihnen die Essenz des Menschlichen gewinnen. Und wer weiss, ob das nicht wirklich so ist? Als sei ihr eine zerbeulte Konservenbüchse ein strahlend vieldeutiges Zeichen und eine ausgequetschte Zahnpastatube in der Sprache der Undinge ein neues Wort. Als ob aus jedem Tümpel, der im schlimmsten Slum herrlich den hellen Himmel und drin vielleicht noch das halbe Hinterrad eines Motorrads spiegelt, tatsächlich der Froschkönig herausschaue, der in Grünspan (1982) steinern leibhaftig aus einem Brunnen steigt, geht es zu, wenn die Kamera jenseits jeder konventionellen Wertung im Überfluss des Gerümpels ihre Wahl trifft und die Dinge, die sie aufgreift, ins richtige Licht setzt. Richtig im Sinn einer Ordnung, der es im Abschaum ebenso wie im Unrat oder im Unkraut oder in der Schmuckschatulle immer nur um die Qualität geht, die in der Komposition der Dinge zum Bild den Ausschlag gibt.
Wenn sich dieses Prinzip auch vorerst rein ästhetisch auswirkt, verdankt es sich doch einem Hang zur Anarchie, die mit der Differenz zwischen Ding und Unding auch andere, vermeintlich unabdingbare Unterschiede aufhebt. So kann in Grünspan das Liebesobjekt einer rothaarigen, hinter einer Sonnenbrille unserer Indiskretion entrückten Prinzessin unserer Tage nicht nur ein steinerner Frosch, sondern auch ein lebendiger Hund oder eine Statue sein. Gleichviel, ob Heldenjüngling oder Stier. Es geht so zu, als ob die Kamera die Gegenstände zunächst auf ihre Gleichwertigkeit reduzieren müsste, damit sie dann auf der Tabula rasa der Leinwand wie neugeboren als sich selber zur Geltung kommen können. Als sei in Polstermöbel im Grünen (1984) der ausgediente Lehnstuhl ein Naturereignis und in Ein halbes Leben (1983) die fleischfarbene Zelluloidtüte für die ausgekämmten Haare ein Relikt aus einer untergegangenen Kultur, sprechen sie sich aus, sprechen sie uns an; nicht anders als die Gemälde, die in Empathie und panische Angst (1989) die Praxis der Psychotherapeutin Ute Binder in eine urzeitliche Höhle verwandeln, oder die Ohrringe, die zwischen Karolas Lippen hängen, als würden sie sich gleich zur Sprechblase entfalten. Das tun sie auch, selbst wenn sie sich wortlos mitteilen. Wenn auch nur im «Als ob» der filmischen Fiktion.
Dass in Noll Brinckmanns Welt die Dinge in einem gewissen Sinn gleichwertig sind, heisst nicht, dass sie nicht zueinander in Widerspruch treten können. So sind zwar die Amateurfilme des Vaters ungeachtet ihrer zweifellos geringeren filmischen Qualität doch den kunstvollen Produkten der Tochter gleich zu achten, wenn es darum geht, sie in ein und demselben Film miteinander ins Gespräch zu bringen. Dann aber auch wieder nicht, wo sie – die einen farbig, die andern in schlichtem Helldunkel – auf zwei Ebenen verlegt sind, die trotz sorgfältig angelegter Entsprechung immer wieder zueinander in Gegensatz treten: auf der einen Ebene die Dokumentation eines längst vergangenen Ereignisses, auf der andern die Bedeutung, die es in der aktuellen Durchleuchtung des Überlieferten gewinnt.
Auch wenn alle Teile eines Films eigens für ihn gedreht sind, kommt es immer wieder vor, dass mit dem Kontrast schwarzweiss/farbig verschiedene Ebenen voneinander abgehoben werden. In Empathie und panische Angst sind schwarzweiss diejenigen Partien, die der Psychotherapeutin Ute Binder gelten, während sich die farbigen vor allem auf ihre Zeichnungen und Gemälde konzentrieren, sie als Malerin vorstellen. Das sporadisch im sonst schwarzweissen Dokument The West Village Meat Market auftretende Rot rückt uns bald auf den Leib, bald schafft es, als reine Farbfläche die Berichterstattung unterbrechend, Distanz. Hin und her gerissen zwischen Abscheu und Interesse, schauen wir den Schlächtern zu, die nicht anders als ihre Kollegen in weniger verschrienen Berufen ihre Arbeit tun: sauber, präzis, effizient. Ein halbes Leben bringt in einer witzig melancholischen Brüskierung der Erwartung nicht die lebendigen Menschen, ein nur von hinten sichtbares älteres Paar, farbig ins Spiel, sondern das abgewohnte Schlafzimmer, in dem sie – wie alle, die ein bürgerliches Zuhause haben – schliesslich ihr halbes Leben verbracht haben werden. Auf eine andere Art wird die Farbe eingesetzt in Grünspan, wo die zum Thema erhobene Verwitterung einer Reihe männlicher Bronzestatuen im Imponiergehabe in einen durchaus sinnvollen Komplementärkontrast tritt zu den roten Haaren der Frau, die umsonst mit ihrem sprichwörtlich weiblichen Fingerspitzengefühl deren eherne Schenkel liebkost. Die Differenz zwischen den zusammengehörenden, in ihrer Farbigkeit kaum voneinander abgehobenen Filmen Dress Rehearsal und Karola 2 (1980) ist sehr viel subtiler. Obwohl die Protagonistin da und dort dieselbe, überaus intensive Karola ist, steht sie doch je in einer andern Beziehung zur Gesprächspartnerin, die hinter der Kamera unsichtbar präsent ist, so dass im Rückblick auf die beiden Filme schliesslich auch die eine Karola mit der andern in einen ergiebigen Konflikt tritt. Sehr oft sind in Noll Brinckmanns Arbeiten die Menschen lediglich vertreten durch die Dinge, die sie gemacht, gehätschelt, vernachlässigt und oft bereits wieder zerstört haben; eine Welt, die sich in ihrer Künstlichkeit scharf absetzt von der Vegetation, die – beispielhaft in Polstermöbel im Grünen – in absehbarer Zeit die menschlichen Spuren zum Verschwinden bringen wird. Durchgehend ist in Brinckmanns Filme ein Gefälle eingebaut, in dem die an sich undramatische Bildfolge eine packende Dynamik gewinnt. Widersprüche führen zu Gesprächen, in denen es nicht glatt geht. Und wenn auch in den Filmen kaum je etwas Handgreifliches geschieht, löst doch das, was sich in ihnen tut, Wellen aus, die sich ins Unabsehbare fortsetzen. Ob wohl der Boden unter unseren Füssen leise schwankt oder ob wir selber das Gleichgewicht verloren haben, mögen wir uns fragen, wenn dann das Licht wieder angeht. Sassen wir eben noch in einem Sessel oder, mitten im Film als einem beinahe unmerklich bewegten Gewässer, in einem Boot?
Während sich in Der Fater die Tochter – mit einigen sorgfältig eingepassten Ausnahmen – vor allem Dinge und Dokumente vornimmt, richtet sich die Aufmerksamkeit des Vaters auf Spektakuläres. Die Filme, die der Arzt, Ethnologe, Jäger in seiner Wahlheimat China und auf seinen Reisen gedreht hat, gelten der Sensation eines Augenblicks, der sich so nie wieder geben wird: einem Jungen, der auf eine Palme hinaufspaziert und ein wenig später wieder herab, einer Kobra, die aus ihrem Korb herauszüngelt, einem Fakir, der sich in einer Besorgnis erregenden Verrenkung seiner Glieder zum Knoten schlingt und da und dort dem Vater selber, wie er vom Boot aus mit lautlosem Schuss eine Ente erlegt, wie er sich mit einer kapitalen Jagdtrophäe oder mit einem lokalen Würdenträger in Szene setzt. Auch wenn der Vater nicht selber mit im Bild ist, lässt sich im Lachen der kleinen Tochter, die ihm entgegenläuft, oder in der verlegenen Miene anderer Objekte seines Interesses sein Anspruch auf die Starrolle mühelos ablesen. Was er auf den Film bringt, nimmt er in Besitz als eine Kostbarkeit, die ein für alle Mal dem Vergehen entzogen und für die Nachwelt aufbewahrt werden soll; eine Nachwelt freilich, die seine filmischen Aufzeichnungen nur noch als die beiläufige Dokumentation eines nie wieder zu betretenden Damals erfahren kann. Die Leistung der Tochter besteht darin, dass sie das Filmmaterial, das mit anderem Gerümpel jahrzehntelang im Estrich gelegen haben mag, gleichsam ediert und zur Wirkung bringt als das, was es bestenfalls sein kann: nicht ein Beweis für das, was der Vater war und geleistet hat, sondern eine Spur, die man aus den vorhandenen Zeugnissen erst herauslesen, die man beschnuppern und auf ihre mögliche Bedeutung hin befragen muss. Im Zug dieser Umdeutung wird das gegebene ergänzt durch zusätzliches Material, das nicht nur andere Dimensionen der Vergangenheit, sondern auch die gegenwärtige Position der Tochter ins Geschehen einbringt.
Glorios kündigt sie ihre Sicht der Dinge an, wenn sie nach den ersten Proben der väterlichen Kunst ein Farbbild der Chinesischen Mauer einfügt; eine unvorhersehbar verlaufende Zackenlinie, mit kühner Geste hineingeworfen in einen Raum, der mit dieser Geste erst eröffnet und für weitere Bilderfolgen sozusagen bewohnbar gemacht wird. So weben sich ständig neue Elemente in den überlieferten Stoff ein. Beispielhaft zugleich die zeitliche Ferne anzeigend und die Illusion von Nähe provozierend wirkt eine Aufnahme der Kamera des Vaters, die in einem offenen, violett ausgeschlagenen Koffer ruht. Ein ganzer Stern von Möglichkeiten geht auf in den vergilbten Photographien, den mit chinesischen Schriftzeichen beschriebenen Papieren aus dem Nachlass des Vaters, den mit Schmetterlingen und Blumen farbenprächtig bestickten Seidenstoffen aus den Sammlungen der Tochter. Aufnahmen aus dem heutigen China setzen den zum Teil noch in archaisch anmutenden Bräuchen befangenen Menschen aus der Zeit des Vaters die Bevölkerung von heute entgegen. Besonders eindrücklich sind die Passagen, wo die Tochter den Kinderbildern von damals andere zur Seite stellt, die zeigen, wie sie sich – jetzt – selber als Kind empfindet: nicht wie sie sich damals dem Vater zeigte, sondern da in einem zeitgenössisch naiven Gemälde, das ein zauberhaftes kleines Mädchen aus seinem Geheimnis heraus ins Licht hebt, und dort in einem in unseren Alltag eingebetteten Kind, das ungerührt in die Kamera blickt; das nicht wie das mit unsicherem Schritt ihr entgegeneilende Töchterchen im Bann eines entschlossen, sich seiner bemächtigenden Blicks steht. So wird in einer immer wieder sich an der Vorgabe orientierenden Arbeit stets ein scheinbar Festgelegtes von neuem aufgebrochen auf Einblicke und Durchblicke hin, in denen die Gestalten erst zu atmen, die unlesbaren Schriftzeichen zu sprechen beginnen. Als ob jetzt, im Rückblick auf den Anfang, die Chinesische Mauer zum Banner geworden wäre, das unhörbar im Wind flattert. Das, was die Tochter als Vergangenheit ihres Vaters zugänglich macht, war so, wie es der Film zeigt, nie da. Es ist nur wirklich in der Kunst, die es ins Leben gerufen und verbindlich in Form gebracht hat.
Der Raum, den Noll Brinckmanns vielschichtige Perspektive den Gestalten, den Gegenständen ihrer filmischen Gemälde eröffnet, kann sich in der zunehmenden Transparenz des Bildes verflachen, sich in Trübung oder Verdunkelung in sich selbst zurücknehmen. Was eben noch ein Gegenstand war, der seine Geschichte, seine Bedeutung hatte, wird zum Element eines Bildes, das mit ihm nichts mehr gemein hat als Umriss und Farbe; als die raue oder glatte Struktur seiner Oberfläche, seiner Haut. So kann das, was wir eben noch als eine Strasse, ein Trottoir und dahinter, aufrecht, eine Mauer erkannt haben, sich auf eine spannungsvoll ausgewogene Anordnung horizontaler Streifen reduzieren. Ein anderer Ausschnitt aus einem der Räume, die immer wieder die Kamera auf ihre formalen Qualitäten hin absucht, kann sich in seiner für Noll Brinckmanns Arbeiten charakteristischen, streng diagonalen Gliederung als Gegenkraft zu der wuchernden Vegetation auswirken, die immer wieder mit dem Hang zur geometrischen Strenge in Konflikt tritt. Oder umgekehrt. Auch der Streit zwischen den Emotionen beruhigt sich nicht in einer Hierarchie. Die ergibt sich erst, wo der Übergang von einem Bild zum andern in Frage steht: wo sich das sorgfältig souverän vor allem nach Farbe und Form geschnittene Material zum Werk fügt.
So tritt im frühlingshaft klaren Licht des Filmgedichts Stief (1988) das zugleich geringe und prachtvolle Stiefmütterchen nicht nur zur Lilie oder zur zarten Petunie, sondern auch zu sich selber in eine stets wieder von neuem überraschende Beziehung. Blumen als Schattenriss, Blumen im Wind erscheinen vor einem Hintergrund aus blauer Plastikfolie und sind dann wieder gedämpft, verschwommen sichtbar durch eine eigenartig getigerte, halbdurchsichtige Materie hindurch. Als Beigabe zu den Blumen können alle möglichen Dinge dazukommen, wenn sie sich nur ins Bild einfügen; ein Porzellanelefant ebenso wie eine Fischerkugel, energisch in Form gebracht ein chinesisches Seidentuch, ein kaputter Spiegel, eine Kristallschale, die wie die Iris eines riesigen Auges aus dem Stillleben herausblickt, ein roter Teller, ein perlmutterartig schimmerndes Glas. Je nach Situation spricht ein Ding für sich, oder es fügt sich der Verwandlung, die das Blumenstück für die Dauer eines Augenblicks zu einem kaum mehr gegenständlichen Bild macht, bevor es in einer neuen Entwicklung wieder ins problemlos Benennbare zurückgeholt wird. Es gibt nichts, was in diesem zugleich zögernden und – bei aller Langsamkeit – doch mitreissenden Fluss der Erscheinungen nicht seine Bedeutung finden könnte. So wie die Müllerstochter Stroh zu Gold spinnt, macht Brinckmann – nirgends so eindrücklich wie in Stief, im Prinzip aber überall – aus beliebigen Belanglosigkeiten eine Kostbarkeit, die man zwar nicht in Besitz nehmen kann, die aber doch – mit Licht gemalt – einleuchtet, als ob es das Leben selber wäre. Oder sogar mehr als das? Intensiver als vor einem faktischen Blumenbeet haben wir erfahren, was Blumen sein können: Im Wind. Im Licht. Im Schatten. In dieser oder jener Komposition.
Wo sich die Bilder lesen lassen wie Andeutungen des nie greifbaren Urtexts, in dem sich auf ihre Weise die sichtbare Welt artikuliert, spielt die Sprache, mit der wir uns zu verständigen, unserer Meinung Ausdruck zu geben pflegen, kaum eine Rolle. Wo Wörter ins Bild treten, zum Beispiel auf den Tafeln, die in der Fleischhalle «SUCKLING PIGS ALL SIZES» oder «TONGUES, TAILS, FRESH BLOOD» anpreisen, sagen sie mehr – und anderes –, als sie in ihrer gewöhnlichen Umgebung sagen würden. In einer geöffneten Schublade finden wir nicht nur eine Dose mit der ursprachlich anmutenden Aufschrift «KALODERMA», sondern auch einen Krimi, der mit dem suggestiven Titel Wo waren sie heute Nacht? hart in die nur von einem gelegentlichen Klaviergeklimper begleitete Bildergeschichte eingreift. Ein Bibelspruch über einem der Ehebetten in Die Urszene bleibt beinahe unleserlich. Das Wort «FATER» verdankt sich in dieser verfremdenden Schreibweise einem Traum. Eine weggeworfene Zeitung in Polstermöbel im Grünen bringt mit dem Hinweis auf ein Verbrechen einen Albtraum in Gang, der sich erst allmählich, mangels Nahrung, wieder beruhigt: Als ob sie nur Leseanweisungen zu geben, das Publikum in eine andere Bewusstseinslage hinüberzukatapultieren hätten, werden die sprachlichen Elemente verwendet. Gesprochen wird nie.
Mit Ausnahme des dezidiert auf die Vermittlung einer Botschaft ausgerichteten Dokumentarfilms Empathie und panische Angst, der unter Brinckmanns Filmen eine Sonderstellung einnimmt. Es erzählt die Psychotherapeutin Ute Binder, umgeben von ihren schlangenhaft ornamentalen Bildern, von ihrer Arbeit mit schizophrenen Patienten; eine Pionierleistung auf einem Gebiet, wo Gesprochenes selten beim Wort genommen, zum Verständnis der nicht nachvollziehbaren «typisch schizophrenen» Befindlichkeiten benützt wurde. Der Monolog, in dem Ute Binder ihre nicht auf Heilung, sondern immer wieder nur auf momentane Linderung bedachte Methode erläutert, ist in seinem Verzicht auf allgemein gültigen Befund glasklar verständlich. Nie zielt er im Vornherein auf etwas Bestimmtes ab, sondern er bewegt sich, präzis erläuternd, von Fall zu Fall; stets von neuem das Gegebene auf seine Möglichkeiten durchleuchtend. Während die Kamera sich immer wieder von der gewissenhaft nach Worten suchenden Frau abund, den Wänden entlanggleitend, ihren Gemälden zuwendet, stellt sich in der zwischen Hören und Sehen gespaltenen Aufmerksamkeit eine eigenartige wechselseitige Beeinflussung der auf getrennten Bahnen verlaufenden Wahrnehmungen her. Nicht so, dass der eine Strang den andern ergänzen würde, sondern eher in der Weise, dass der eine den andern in seinem Mangel bestärkt. Wo im Bildhaften auf die Zentralperspektive verzichtet wird, die es erlauben würde, das Bild mit einem Blick zu erfassen, wird im Gesprochenen jede Definition vermieden, die es ein für alle Mal verfügbar machen würde. Was nicht zu sagen, nicht zu überblicken ist, wird als solches respektiert. Ob es hier vielleicht nicht nur darum geht, eine in ihrer Zurückhaltung viel versprechende therapeutische Methode bekannt zu machen, sondern auch, allgemein, darum, den Wert des Ausgesparten, des Verzichts überhaupt begreiflich zu machen; in menschlichen Angelegenheiten ebenso wie im künstlerischen Prinzip? So wie die Therapeutin Binder eher Möglichkeiten eröffnet als bestimmte Anhaltspunkte gibt, so wie sich ihre Gemälde nur lesen lassen, wenn der Blick beweglich bleibt und auf stets wieder neuen Wegen von einem Rätsel zum andern wandert, sind auch Noll Brinckmanns Filme zu nehmen. Als hätte sie in ihrem letzten Film eine Darstellungsweise gewählt, die mit dem behandelten Thema auch ihr eigenes Anliegen in Szene setzt.