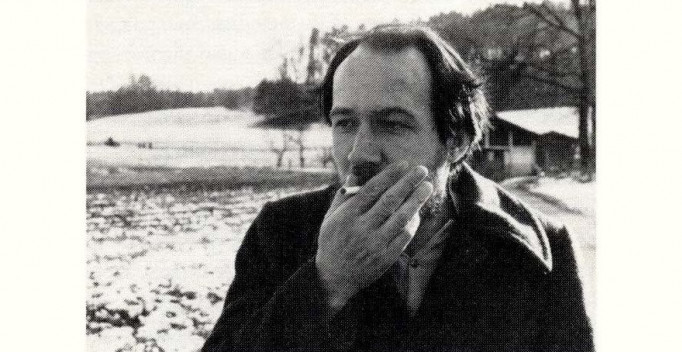Andreas, das älteste von fünf Geschwistern, verlor mit 30 Jahren bei einem Gasunfall das Gedächtnis und ist seither geistig behindert. Seine Familie schloss sich damals, vor sieben Jahren, zusammen und versuchte alles, um ihn nicht in eine Anstalt versorgen zu müssen. Nach anfänglichen Fortschritten, sagen seine Angehörigen, habe Andreas plötzlich realisiert, dass er nie wieder „jemand“ sein werde, und von diesem Moment an sei er zunehmend aggressiver geworden, habe die Leute geschlagen. Notfallmässig musste Andreas in die geschlossene Anstalt eingewiesen werden. Wenn die Mutter ihn heute besucht und ab und zu mit ihm spazieren geht, spürt sie seine Erleichterung, wenn er wieder in die Ordnung der Anstalt zurück kann.
Patrick Lindenmaier, der jüngere Bruder, arbeitet mit dem Film Andreas dessen Geschichte auf - für sich, für die Familie. Andreas selbst wird von diesem Film nicht viel haben: Sein Zustand hat sich auf einem tiefen Niveau stabilisiert - ob krankheitsbedingt oder als Folge der Hospitalisierung er wird wohl den Rest seines Lebens in der Abteilung für Langzeitpatienten verbringen müssen. Gefallen hat ihm aber offenbar die Filmarbeit. Die „Action“ rund um seine Person habe bewirkt, dass er ruhiger geworden sei, und auch mit dem Essen sei es plötzlich besser gegangen.
In ruhigen Bildern, ohne interpretierenden Kommentar, beobachtet Patrick Lindenmaier den Alltag (und nicht die Auswüchse) auf der Langzeitstation der Psychiatrischen Klinik, auf der zur Zeit der Filmaufnahmen 23 Patientinnen leben. Allesamt Hoffnungslose: eine Frau, die stupide Arbeit verrichtet; einer, der an seinem grossen Teddybär knübelt (bevor man ihm den Bär gegeben hat, kratzte er sich jeweils die Arme wund); Gestalten, die stumm aneinander vorbei durch die Korridore schleichen. All tag, das heisst: aufstehen, waschen, zur Ausgabezeit Zigaretten fassen, herumsitzen, essen und Medikamente fassen, Fernseh-schauen, Ergotherapie, zu Bett gebracht werden: dieser Tag ist wie der nächste, der übernächste, der überübernächste.
Stimulation von aussen gibt es kaum. Viele Angehörige scheuen längst den Weg in die Klinik fernab der Stadt, nur starke und unerschrockene Leute setzen durch, selbst etwas für einen Insassen tun zu können, sagt Andreas’ Mutter. Lindenmaier lässt Geschwister, Mutter, Anstaltspersonal ausführlich zu Wort kommen: Sie erzählen von Andreas’ Entwicklung, von den eigenen Unzulänglichkeiten, von den Grenzen der betreuerischen Möglichkeiten, sie reflektieren die Institution Psychiatrie, setzen ihr Utopien entgegen.
In letzter Zeit nicht gerade verwöhnt mit Schweizer Dokumentarfilmen, die auf der Tradition der „guten Zeit“ der siebziger Jahre aufbauen und gesellschaftlich relevante Themen behandeln, möchte man Patrick Lindenmaier über allen Klee loben. Er bringt es fertig, die persönliche Lebensgeschichte seines Bruders in der genau richtigen „Dosierung“ mit dem Psychiatriealltag zu verbinden und - nachdem sich der Zuschauer selbst ein Bild davon gemacht hat
eine grundsätzliche Kritik einfliessen zu lassen, die nahe am „Fall“ bleibt. Keines jener aufgeklatschten Einzelschicksal-Porträts, die - wie der Filmkritiker so gerne und repetitiv sagt
„Betroffenheit“ auslösen und auf Mitleid mit einem armen Randständigen aus sind. Keine theoretische Abhandlung, die sich die passenden Beispiele herauspickt, um Recht zu bekommen, und auch kein Irrenanstaltsfilm, der - wie es in letzten Jahren Mode geworden ist - die Insassen zu hochsensiblen Lebenskünstlern idealisiert.
Andreas lässt keine billigen Schlüsse zu: Weder für die „Zufriedenen“, die die Anstalt als „beste Lösung“ akzeptieren, noch für die Reformwilligen, die besser geschultes Personal, mehr Animation verlangen, noch für uns Linke, die wir die Psychiatrie zusammen mit anderen Entsorgungsanstalten als Gradmesser für den Zustand unserer Gesellschaft betrachten und es bei der Forderung „Psychis auf und dann zu“ bewenden lassen. Was wäre eine lebbare Alternative für Andreas? Man kennt die radikalen Versuche eines Franco Basaglia, kennt aber auch die Folgen: Viele der ehemaligen Patientinnen, die in die Gesellschaft entlassen wurden, sind in der Gosse gelandet, allenfalls von den Notschlafstellen aufgegriffen. Logisch, sagt Andreas’ Bruder Christoph: Es bringt nichts, die Anstalten zu schliessen und die Patienten dorthin zurückzuschicken, wo sie krank geworden sind. Es skizziert das Bild einer Gesellschaft, in der nicht mehr alle gezwungen sind, 45 Stunden pro Woche zu produzieren, sondern in der sich die Grenzen zwischen Gesunden und Kranken verwischen. Würde staatlicherseits Geld und Zeit bereitgestellt, könnte ein Grossteil der (psychisch) Kranken draussen betreut werden: „Wir hätten Zeit genug, uns um unsere Irren zu kümmern.“